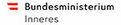Fritz Tränkler, geb. 1910 in Wien, Privatbeamter. Angehöriger des Republikanischen Schutzbunds, nach der Teilnahme an den Februarkämpfen 1934 Flucht in die ČSR, von dort in die Sowjetunion, 1937 Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg, 1939 nach Frankreich, Internierung in den Lagern St. Cyprien, Gurs, Le Vernet, dann Djelfa (Algerien), nach der Befreiung Nordafrikas durch die Alliierten Mitglied des britischen Pionierkorps, zurück in die UdSSR. Sommer 1944 gemeinsam mit einer in der Sowjetunion ausgebildeten Gruppe Absprung über den befreiten Gebieten Sloweniens, August 1944 nach Österreich, Bildung der "Kampfgruppe Steiermark", die im Gebiet der Kor- und Saualpe aktiv war.
Nach 1945 Arbeit in der Österreichisch-Sowjetischen Gesellschaft.
Verstorben 1990.
Unser Auftrag war, von Slowenien nach Österreich vorzugehen und dort folgende Aufgaben zu erfüllen: Sabotage und, wenn es geht, mit der Bevölkerung Kontakte aufzunehmen, Nachrichten verbreiten, eventuell auch Einheiten der deutschen Armee angreifen. Das war nicht sehr klar und hat auch nicht sehr klar sein können - unsere Möglichkeiten hingen ja von den örtlichen Bedingungen ab. [...] Wir sind dann losmarschiert, anfangs war es nichts Besonderes, weil wir noch in slowenischen befreiten Gebieten waren. Aber dann sind wir über die Save hinüber. Das ist dort alles sehr gebirgig, jedenfalls sind wir zuerst in Richtung oberhalb von Dravograd marschiert, weil wir geglaubt haben, dass wir dort leichter über die Drau setzen können. Wir haben zu diesem Zweck zwei Schlauchboote mitgeschleppt. Wir sind praktisch nur mehr in der Nacht gegangen. [...] Wir wollten östlich von Lavamünd über die Drau, aber es war dort nicht möglich, weil beide Seiten so befahren waren. Außerdem haben wir sogar am Strom selbst Patrouillenboote gesehen. Wir sind dann wieder nach Süden, ans Eck dieses befreiten Gebietes, haben uns etwas nach Westen gehalten, sind bei Eisenkappel vorbei oberhalb Richtung Drau, und vielleicht 40 oder 50 km westlich von Lavamünd ist es uns gelungen, über die Drau zu kommen. Dann sind wir im Lavanttal hinauf Richtung Saualpe marschiert und oberhalb von Völkermarkt ins Gebirge gekommen. [...] Dann war unsere Aufgabe, in die Steiermark zu kommen und dort einmal südlich der Packstraße vorläufig ins Operationsgebiet zu gehen, bis hinunter zur Drau, eingeschlossen die Gebirge oberhalb des Lavanttales, die Orte Eibiswald, St. Lorenzen, Pölfing-Brunn, Deutschlandsberg. Anfangs war ja eine Gruppe von Jugoslawen von der slowenischen Befreiungsarmee dabei. Wir sind herumgezogen, um einmal die ganze Gegend kennen zu lernen. Wir haben einige Depots angelegt für Munition, Sprengstoff, wir konnten ja nicht immer alles mitschleppen.
Wie kamen die ersten Kontakte mit den Bauern zustande?
Die Slowenen haben Kontakte gehabt, dort waren noch sehr viele slowenische Bauern. Mit ihnen haben wir uns auch später sehr gut verstanden. [...] Uns gegenüber haben ja die Bauern nicht gesagt, dass sie uns feindlich gesinnt sind, sondern sie haben mit uns gesprochen, Auskunft gegeben, sehr vorsichtig natürlich. Aber nachher dann, nach zwei, drei Wochen, sind wir draufgekommen, dass viele dieser Bauern, vor allem der österreichischen Bauern, nachdem wir weg waren, sofort hinunter sind zum Gendarmerieposten und dort die Meldung gemacht haben, dass bei ihnen Partisanen waren oder "Banditen", wie sie offiziell genannt wurden. Das war an und für sich immer das größte Problem, bis zum Schluss. Ich habe schon gute Kontakte gehabt, das hat zu meinen Aufgaben gehört, auch zu österreichischen Bauern, aber da musste man sehr, sehr vorsichtig sein. [...] Das soll aber gar nicht heißen, dass wir ihnen nicht sympathisch waren, dass sie nicht gegen Hitler eingestellt waren - aber die Angst war eine der entscheidendsten Sachen, weil es viele Beispiele gegeben hat, dass die faschistischen Einheiten, sei es Gendarmerie oder SS oder diese litauischen Spezialeinheiten, wenn sie eine Meldung bekommen haben, dass dort oben irgendein Bauer Kontakt mit Partisanen hat, hinauf sind. Dann ist der Hof angezündet worden, oft sind die Leute erschossen worden. [...] Dann haben sich die Leute gedacht, es werde ohnehin nicht mehr lange dauern, wieso jetzt noch unser Leben riskieren. Das war auch so bei einigen Deserteuren, die sich vor der deutschen Armee irgendwo versteckt gehalten haben in unserem Gebiet, die absolut nicht bereit waren, mit uns zu kämpfen oder irgendetwas zu machen. Sie waren zwar gegen Hitler eingestellt, aber nachdem der Krieg ohnehin schon zu Ende ging, wollten sie ihr Leben nicht mehr aufs Spiel setzen. [...]
Die Verpflegung zu bekommen war oft nicht leicht, wir haben immer Mark hergegeben. Ich habe ja Mark mitgehabt, aber wenn sozusagen Jagd auf uns gemacht wurde, und das war ein- bis zweimal monatlich mindestens von größeren Einheiten, dann mussten wir praktisch verschwinden, und da ist es oft hart gewesen mit der Verpflegung. Fleisch war oft kein Mangel, da haben wir halt eine Kuh gekauft oder ein Kalb, und das haben wir dann lebendig mitgeschleppt. Wenn wir es gebraucht haben, ist es geschlachtet worden, und wir haben es gegessen. Aber Brot zum Beispiel, das war Mangelware zu manchen Zeiten, Brot, Mehl, Hülsenfrüchte, Zucker. Wir hatten zwar den Bauch voll, aber nur mit Fleisch. Auf die Dauer verträgt das der Mensch nicht. [...] An und für sich hat die örtliche Gendarmerie immer die Aufgabe gehabt, die Partisanen zu verfolgen. Sie sind am Anfang sehr wohl heraufgekommen, fünf oder zehn Gendarmen, aber sie haben es aufgegeben. Wir sind schließlich immer mehr geworden, zwar im letzten Stadium erst, aber immerhin 20, 30 Leute, die doch halbwegs bewaffnet, auch manchmal verstärkt waren durch irgendeine slowenische Einheit, die über die Drau gekommen ist. Dann ist das meistens so gehandhabt worden, dass aus den anderen Gegenden Truppenteile herangezogen worden sind, SS-Einheiten, Polizeieinheiten, auch kroatische ustaši. Oder es sind reguläre Truppeneinheiten, die in Ruhestellung lagen bzw. sich einige Tage in der Steiermark aufgehalten haben, eingesetzt worden. [...] Erste Feindkontakte haben wir noch in Kärnten drüben bekommen, ein zufälliges Zusammentreffen mit einer Truppe in den Bergen, es sind Schüsse gewechselt worden, aber weiter war nichts los. Wir mussten sehr aufpassen, als wir über die Lavant in die Steiermark hinüber sind, dass wir nicht aufgehalten, nicht beschattet oder in einen Kampf verwickelt werden, weil wenn man am Marsch ist, ist das eine sehr gefährliche Angelegenheit. Partisanen müssen immer dann angreifen, wenn es der Gegner nicht erwartet. Wenn der Gegner im Vorteil ist, ist es am besten, man zieht sich zurück. [...] Wir haben mit jungen Leuten gesprochen, wenn wir welche getroffen haben, was auf den Bauernhöfen manchmal vorgekommen ist, im Alter von 15, 16 Jahren, die vielleicht schon ihre Einberufungsbefehle gehabt haben für das Militär oder für den Arbeitsdienst. Wir haben ihnen gesagt, dass sie sich verstecken sollen, es kann nicht mehr lange dauern, dann ist es zu Ende mit Hitler. Sie werden sich schon ein paar Monate helfen können. Das haben wir sehr oft gemacht, das ist ein Teil unserer Arbeit gewesen. Es war ja nicht möglich, jeden Tag einen Überfall auf eine Gendarmeriekaserne zu machen.
Waren die politischen Bedingungen schwieriger, als Sie erwartet haben?
Schwieriger, viel schwieriger; ich muss sagen, ich bin viel in der Welt herumgekommen, das war meine schwierigste Phase, Partisan sein in einem kleinen Land, wo das Gebiet, das man benützen kann, sowieso nicht sehr groß ist, wo alle paar Kilometer ein Dorf oder sonst etwas ist, das mit Straßen doch verhältnismäßig gut bestückt ist, wo eine Armee- oder Gendarmerieeinheit binnen einer halben Stunde wer weiß wo sein kann, das ist an und für sich nicht leicht. Wenn aber dann noch dazugekommen ist, dass wir von der Bevölkerung sehr wenig Unterstützung erhalten haben, ist es besonders schwer. Dass sie uns wirklich verraten haben, war eine sehr ungute Situation. Ich muss sagen, im Lauf der Monate haben die Bauern mehr Vertrauen zu uns bekommen, weil wir wirklich peinlich darauf bedacht waren, keine Übergriffe gegen die Bevölkerung zu setzen. Weil wir mit den Leuten gesprochen haben. Weil die Aussichten für den Krieg immer schlechter wurden. Außerdem hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass sich diese bewaffneten, faschistischen Einheiten immer seltener ins Gebirge getraut haben. Sie sind ja auf Widerstand gestoßen. [...]
Wir haben gewusst, dass es im Norden, in der Obersteiermark, noch eine kleine Gruppe geben soll, wir haben aber nie Verbindung dorthin bekommen. Es sind auch Leute gekommen, sie wollten zu den Partisanen. Was soll man machen? Der Mann oder die Frau kann genauso von der Gestapo geschickt worden sein, um uns auszuforschen, Leute kennen zu lernen, jedenfalls uns zu schaden. [...] Wir hatten Posten aufgestellt im weiten Umkreis. Der uns suchte, hat einen von unseren Posten getroffen, der ihn aufgehalten hat. Wir haben nicht gleich geschossen, überhaupt, wenn der Mensch unbewaffnet war. Dann ist er mit zu uns, zum Stab gekommen. Man hat geschaut, ob er nicht bewaffnet ist. Sagte er, er möchte zu uns, zur Gruppe, dann hat man den Menschen ausgefragt, woher er kommt, wen er als Garanten angeben kann, was er früher gemacht hat, was seine politische Einstellung ist. Wir haben nicht sehr viele genommen, manchmal eine kleinere Gruppe, das war für uns leichter, als wenn ein Mann allein gekommen ist. Wir haben oft Leute zurückgeschickt, das war uns zu unsicher, außer es waren Leute, die rekommandiert waren von irgendwelchen Leuten in der Gegend, wo wir gewusst haben - das hat es ja auch gegeben, leider nicht sehr viele -, das sind Antifaschisten, die sind bereit, auch uns zu helfen, natürlich nicht offiziell. Solche haben wir uns genommen, obwohl sie immer ein bisschen beobachtet worden sind. [...]
Wir haben zweimal Masten einer Starkstromleitung in die Luft gesprengt. Einmal haben wir einen Gendarmerieposten angegriffen. Das war schon ziemlich weit unten in der Südsteiermark, es war in der Nähe von Eibiswald oder Pölling-Brunn, ich kann mich nicht mehr erinnern. Dann sind wir wieder in Kämpfe verwickelt worden mit Truppen, die uns gesucht haben. Und wir haben immer Zeit gebraucht, um uns wieder in Ordnung zu bringen, um Leute zu suchen, die versprengt worden sind. [...]
Ich habe oberhalb von Eibiswald mit einem Bergbauern sehr guten Kontakt gehabt, da bin ich oft hingegangen. Durch den habe ich auch gewusst, dass eine andere Widerstandsgruppe existiert, die an und für sich nicht viel gemacht hat, aber Gegner des Faschismus war, über ihn habe ich Kontakt bekommen zum späteren Landeshauptmann der Steiermark, Krainer. Mit dem bin ich einmal illegal zusammengekommen. Ich habe versucht, eine bestimmte Zusammenarbeit herzustellen. Er war sehr zurückhaltend, muss ich sagen, beleidigend fast, er wollte mit uns keinen Kontakt haben. Er fragte, was sie denn machen könnten. Ich sagte zu ihm: "Schauen Sie, Sie kennen doch die Gegend, Sie sind Steirer, Sie kennen sicher Bauern oder Leute, die wirklich Antifaschisten sind, und wenn wir mit denen, auch mit Einzelnen von ihnen zusammenarbeiten könnten, wäre das ein großer Vorteil für uns, wir könnten uns dann leichter bewegen und politische Arbeit leisten, oder Sie kommen ja auch nach Graz" - er war sehr selten in Graz, meistens hat er sich draußen herumgetrieben in den Bergen mit seiner Jagdflinte, wir hatten das irgendwie eruiert - "Nachrichten hört man viel, die man militärisch verwenden kann." Er hat aber strikt abgelehnt und gesagt, er werde vielleicht hier bei dem Bauern Nachricht hinterlassen. Aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. [...] Als einer der Italiener schwer verwundet wurde, der hat einen Schuss ins Gelenk bekommen, wir haben längere Zeit keine Möglichkeit gehabt, ihn nach Slowenien zu transportieren, habe ich ihn bei diesem Bauern untergebracht. Der ist gelähmt mindestens zwei Wochen im Heustadel oben gelegen. Ich bin da alle paar Tage, wenn es gegangen ist, zu ihm hin, habe Medizin mitgebracht. Der hat eine offene Wunde und fürchterliche Schmerzen gehabt, und ich habe ihm das Pulver, Antibiotika, einfach in die Wunde hineingeschüttet und wiederum verbunden.
Einmal bin ich zu dem Bauern gekommen, wenn mich nicht alles täuscht, war auch der Walter Wachs mit. Kaum sprechen wir mit dem Bauern, sieht der Sohn, der zufällig draußen vor dem Haus war, dass eine Militärpatrouille kommt. Wir sind natürlich sofort aus dem Haus, hinauf in den Heustadel, haben uns mit dem Verwundeten ins Heu eingegraben, haben Handgranaten vorbereitet. Diese Patrouille war zwischen 20 und 25 Mann stark. Sie waren scheinbar schon öfter bei dem Bauern, haben Most bekommen, Brot mit Schmalz, sind draußen im Hof gesessen und wir fünf Meter entfernt im Stadel. Sie haben einen Hund mitgehabt, der hat herumgeschnüffelt und ist auch in die Scheune hinein. In der Mitte war ein Gang, und links und rechts war das Heu bis zum Dach gestapelt, und er ist nicht von der Seite weggegangen, wo wir gelegen sind. Das ist dann dem Patrouillenführer aufgefallen und er hat den Bauern gefragt, was er denn drinnen im Stadel hätte, der Hund schnüffelt dort herum. Darauf sagt der Mann in aller Ruhe, dass dort oft Nester von den Hühnern seien mit Eiern, das wird der Hund wahrscheinlich riechen. Trotzdem hat der Bauer nicht die Verbindung mit uns abgebrochen. [...] Diese Kontakte waren aber viel zu wenige. Dann ist der Winter vorbeigegangen. Im Winter, wenn wir gejagt worden sind, wenn es da vielleicht zehn, 20 Grad unter Null hat, und man muss im Wald übernachten, das ist sehr schlimm, wir haben uns dann etwas eingerichtet nach Erfahrung, mit Ästen von Tannen oder Fichten, die haben wir dann aufgebreitet, eine Decke oder eine Zeltplane oben oder unten, haben uns aneinandergeschmiegt, und so haben wir die Nacht irgendwie überstanden.




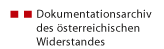







 English
English Termine
Termine Neues
Neues