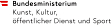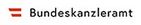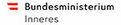Hier finden Sie mit den Objekten des Monats unseren Neuzugang in der Dauerausstellung des DÖW. Monat für Monat werden wir Ihnen hier neue, unbekannte oder womöglich zu wenig beachtete Objekte und deren Geschichte aus unseren Sammlungen präsentieren. Hier erfahren Sie zudem die wichtigsten Hintergründe zu den Objekten und die Motive für deren Auswahl.

Schuhlöffel aus dem Schuhhaus Graubart, dessen Miteigentümer Richard Graubart 1938 in Innsbruck ermordet wurde
Signatur: DÖW, M703
In jeder Stadt gibt es Geschäfte, Kaffeehäuser und Kinos, auf die ihre Bewohner*innen stolz sind. Das Innsbrucker Schuhhaus Graubart in der Museumsstraße 8 war lange Zeit eines davon. Mit geschwungenen Buchstaben auf der Fassade verwies es auf seine lange Tradition: gegründet 1888. Der Schuhlöffel aus der Sammlung des DÖW bewirbt das Geschäft sogar als „das größte Schuhhaus Innsbrucks“.
Angehörige der Familie Graubart führten das Schuhwarengeschäft über viele Jahre, sie waren gleichzeitig engagierte Mitglieder in der Israelitischen Kultusgemeinde Innsbruck. Der „Anschluss“ Österreichs ans Deutsche Reich bedeutete für die 365 Innsbrucker*innen, die sich bei der Volkszählung 1934 zur israelitischen Religion bekannten einen Bruch, so auch für die Graubarts. Der Alltag, wie sie ihn kannten, war vorbei.
Ab März 1938 kam es zu massiven Ausschreitungen gegenüber Jüd*innen, besonders in Wien, aber auch in anderen österreichischen Städten und Gemeinden. Nationalsozialisten diskriminierten und beraubten als jüdisch definierte Bürger*innen, im September war auch das Schuhhaus nicht mehr im Familienbesitz, denn Karl Kastner und Rudolf Mages „arisierten“ es. Knapp zwei Monate später ermordeten Mitglieder eines SS-Kommandos im Zuge der Novemberpogrome Richard Graubart, den früheren Miteigentümer des Schuhhauses. Sie drangen in der Nacht vom 9. auf den 10. November in seine Wohnung in der Gänsbacherstraße 5 ein, sperrten seine Familie in ein Nebenzimmer und verletzten ihn mit einem Messer tödlich. An derselben Adresse ermordeten sie auch Wilhelm Bauer. Weitere Todesopfer der nationalsozialistischen Aktion in Innsbruck waren Karl Bauer und Richard Berger. Über 90 Männer aus den Reihen der SA, der SS und des NSKK beteiligten sich an den Ausschreitungen, mindestens 38 Jüd*innen wurden zum Teil schwer verletzt. Wer konnte, floh – so auch Margarethe Graubart und ihre Tochter Vera. Ihnen gelang nach dem Mord an ihrem Mann bzw. Vater getrennt voneinander die Flucht nach England.
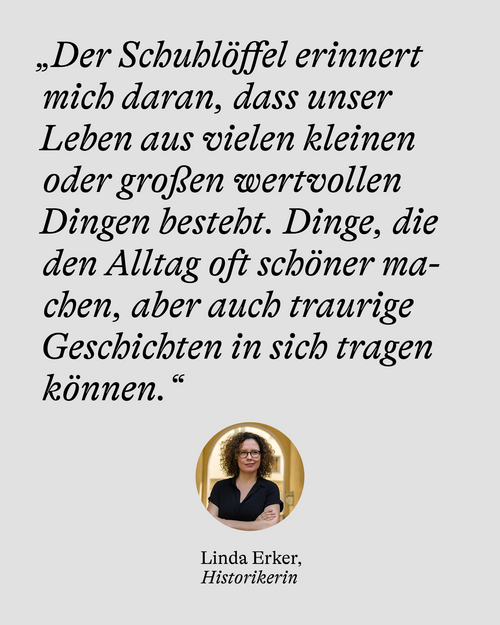
Die juristische Verfolgung der Täter des Innsbrucker Pogroms erstreckte sich ab 1945 über knapp 20 Jahre. Johann Feil, der verantwortliche Befehlsgeber der Mordaktionen, Gewalttäter wie Erwin Fleiss und die mutmaßlichen Mörder Benno Bisjak, Franz Dobringer und Gerhard Lausegger entzogen sich der österreichischen Justiz dauerhaft. Sie flüchteten nach Argentinien und kehrten nie wieder zurück.
Weiterführende Literatur:
- Interview mit Vera Graubart (2012): https://www.weitererzaehlen.at/interviews/vera-graubart
- Orte des Novemberpogroms 1938 in Innsbruck. Virtuelle Stadtrundfahrt zu den Schauplätzen des Judenpogroms in Innsbruck vom 9. auf den 10. November 1938: https://www.novemberpogrom1938.at
- Thomas Albrich/Michael Guggenberger, „Nur selten steht einer dieser Novemberverbrecher vor Gericht“. Die strafrechtliche Verfolgung der Täter der so genannten „Reichskristallnacht“ in Österreich, in: Thomas Albrich/Winfried R. Garscha/Martin F. Polaschek (Hg.), Holocaust und Kriegsverbrechen vor Gericht. Der Fall Österreich, Innsbruck-Wien-Bozen 2006, 26–57.
- Thomas Albrich (Hg.), Die Täter des Judenpogrom in Innsbruck, Innsbruck-Wien 2019.
- Günter Fellner, Der Novemberpogrom 1938 in Westösterreich, Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde (139/1990), 725–738.
- Michael Gehler, Spontaner Ausdruck des „Volkszorns”? Neue Aspekte zum Innsbrucker Judenpogrom vom 9. und 10. November 1938, in: Zeitgeschichte, Heft 1/2 (1990/91), 2–21.
Autorin: Linda Erker, Historikerin
Fotos: Michael Bigus (Objekt), Daniel Shaked (Porträt)




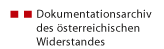


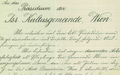


 English
English Termine
Termine Neues
Neues