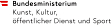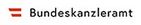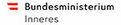Monat für Monat präsentieren wir Ihnen in unserer Dauerausstellung ein Objekt des Monats. Dabei handelt es sich um neue, unbekannte oder womöglich zu wenig beachtete Objekte und deren Geschichte. Der Schwerpunkt des Jahres 2026 liegt auf Neuzugängen zu unseren Sammlungen.

Geschnitztes Herz von Franz Plotnarek, der 1943 als Widerstandskämpfer hingerichtet wurde
Signatur: DÖW, M 947
„Begonnen hat er damit am Mittersteig, überall anders wäre es nicht gegangen“, erzählte Grete Plotnarek, genannt Maxi, im Interview Luis Stabauer über die Schnitzereien, die ihr Vaters Franz Plotnarek in nationalsozialistischer Haft angefertigt hat. Eine davon zeigt die Aufschrift „zum 10. Geburtstag“ auf einem roten Herz, ein Geschenk für seine Tocher. „Meine Mutter hat ihm offiziell Lebertranflascherl geschickt. Er hat sie zerbrochen und mit den Glasscherben das Holz geschnitzt. […] Wir haben gewusst, dass er auch für die Aufseher schnitzt […] Sie haben ihm dann Werkzeug gegeben […] auch Farben hat er bekommen, um das Holz anzumalen. […] Zu meinem zehnten Geburtstag hat er – auch so zehn Zentimeter groß und nicht flach, sondern richtig plastisch – ein erhobenes rotes Herz auf einer Treppe […] gemacht.“ (Zitat: Stabauer, Der Kopf meines Vaters, S. 59)
Die Inhaftierung durch die Nationalsozialisten im Jänner 1941 war nicht die erste Repressionsmaßnahme, die der 1904 in Wien geborene Mechanikergehilfe Franz Plotnarek aus Ottakring erleben musste. Bereits 1934 war er mit drei Monaten Schwerem Kerker bestraft worden, da er Waffen für den Republikanischen Schutzbund, dem Wehrverband der Sozialdemokratischen Partei, versteckt hatte. Außerdem unterstützte er die Witwe seines Freundes Otto Schmidt, der 1937 im Spanischen Bürgerkrieg als Mitglied der Internationalen Brigaden gefallen war, mit Geldspenden.
Nach dem „Anschluss“ im März 1938 setzte Plotnarek seine Tätigkeit fort und baute gemeinsam mit anderen eine kommunistische Widerstandsgruppe auf. Im Zuge einer Aktion gegen die illegale Kommunistische Partei (KPÖ) wurde er am 31. Jänner 1941 festgenommen und ins Gerichtsgefängnis Margareten, der heutigen Justizanstalt Wien-Mittersteig, gebracht, wie aus den Tagesrapporten der Gestapo-Leitstelle Wien hervorgeht. Plotnarek wurde beschuldigt, von 1938 bis zu seiner Verhaftung der KPÖ angehört, zeitweise als Bezirkskassier tätig und an der Herstellung und Verbreitung von mindestens sieben kommunistischen Flugschriften beteiligt gewesen zu sein.
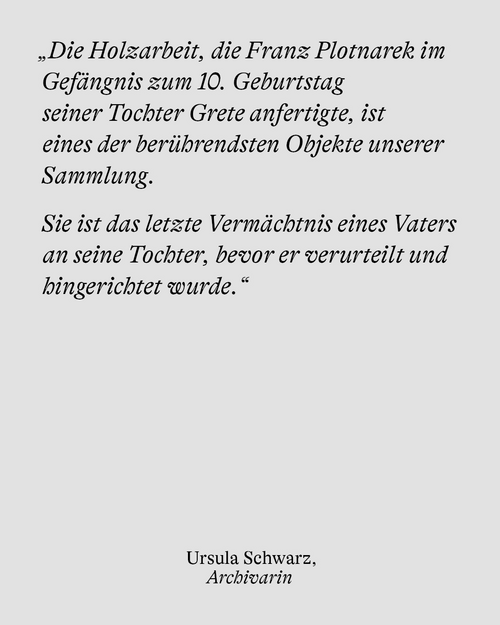
Plotnarek wurde am 7. Juli 1942 wegen der Delikte „Vorbereitung zum Hochverrat“ und „Feindbegünstigung“ gemeinsam mit sechs weiteren Personen angeklagt. Am 15. Dezember 1942 fand die Verhandlung vor dem in Wien tagenden nationalsozialistischen Volksgerichtshof statt. Plotnarek wurde gemeinsam mit Franz Fiala, Anton Tuma, Johann Meduna und Karl Kompers am 15. Dezember 1942 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode verurteilt. Über die beiden weiteren Angeklagten wurden Zuchthausstrafen verhängt. Plotnarek wurde am 16. März 1943 um 18.38 Uhr im Hinrichtungsraum des Landesgericht Wien enthauptet. An diesem Tag wurden 16 Personen hingerichtet, darunter auch Fiala, Tuma und Meduna. Das fünfte in dem Verfahren ausgesprochene Todesurteil an Karl Kompers wurde ein knappes Monat später am 13. April 1943 vollstreckt.
Grete Machalek (geb. Plotnarek) übergab das für ihren zehnten Geburtstag geschnitzte Herz gemeinsam mit weiteren Schnitzereien ihres Vaters an das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Anlässlich der Übergabe der Schnitzereien sagte Grete Machalek, dass diese zur Erinnerung an ihren Vater verwahrt und ausgestellt werden sollten. Damit würde das Gedenken an ihren Vater auch abseits seiner eigenen Familie bewahrt bleiben.
Weiterführende Literatur:
- Manfred Mugrauer, Widerstand und Verfolgung in Rudolfsheim-Fünfhaus 1938–1945. Eine Dokumentation, herausgegeben vom Museumsverein Rudolfsheim-Fünfhaus in Kooperation mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien 2024.
- Wolfgang Neugebauer, Der österreichische Widerstand 1938–1945. Überarbeitete und erweiterte Fassung, Wien 2015.
- Luis Stabauer, Der Kopf meines Vaters: Wien von der NS-Zeit bis zur Gegenwart. Eine Zeitzeugin erzählt, Hamburg 2009.
Autorin: Ursula Schwarz, Archivarin
Foto: Michael Bigus




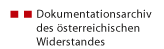


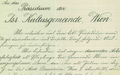


 English
English Termine
Termine Neues
Neues