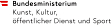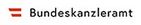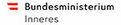Hier finden Sie mit den Objekten des Monats unseren Neuzugang in der Dauerausstellung des DÖW. Monat für Monat werden wir Ihnen hier neue, unbekannte oder womöglich zu wenig beachtete Objekte und deren Geschichte aus unseren Sammlungen präsentieren. Hier erfahren Sie zudem die wichtigsten Hintergründe zu den Objekten und die Motive für deren Auswahl.

Mauerstück des gesprengten Krematoriums im KZ Auschwitz-Birkenau
Signatur: DÖW, M 861
Die Krematorien von Auschwitz gehören zu den wohl stärksten Zeugnissen des Holocaust. Sie stehen für die Ermordung von einer Million Jüd*innen aus ganz Europa in Auschwitz-Birkenau allein. Die Leichen der Opfer wurden in den Krematorien verbrannt, dadurch Beweise vernichtet, um zynisch Platz für weitere Morde zu schaffen. Es hätte keinen Friedhof gegeben, auf dem man all die Toten verscharren hätte können. Der junge Schriftsteller Tadeusz Borowski hatte sich nach dem Krieg in seinem Buch „Bei uns in Auschwitz“ an ein Fußballspiel der Häftlinge an einem Sonntag erinnert. In gnadenlosen Sätzen beschrieb er die Normalität der permanenten Vernichtung. „Ich bin mit dem Ball zurück und gab ihn zur Ecke. Zwischen zwei Eckbällen hatte man hinter meinem Rücken dreitausend Menschen vergast.“
Die Krematorien von Auschwitz stehen damit wie kaum sonst etwas für die deutsche und österreichische Täterschaft. Sie stehen für KZ-Kommandanten wie Rudolf Höß, der den Gasmord für „human“ hielt, für die selektierenden SS-Ärzte an der Rampe von Auschwitz, für österreichische Polizisten wie Maximilian Grabner, der als Leiter der Politischen Abteilung Folter und Terror organisierte. Und sie stehen für das Know-how der Ingenieure, ohne das der penibel geplante Massenmord nicht hätte durchgeführt werden können, also für private Firmen wie Topf & Söhne, die sich einen Wettbewerbsvorteil erhofften, indem sie beim Patentamt einen aus der Tierkadaververwertung entwickelten, „kontinuierlich arbeitende[n] Leichen-Verbrennungsofen für Massenbetrieb“ anmeldeten.
Sie stehen aber auch für den Widerstand im KZ Auschwitz: Für das „Sonderkommando“, das – die eigene Vernichtung vor Augen – die jüdischen Deportierten entkleiden und in die Gaskammern führen musste. In einer völlig aussichtslosen Lage probte es den Aufstand, als die SS damit begann, die Mitglieder des „Sonderkommandos“ zu ermorden. Geplant war der Aufstand für Sommer 1944, durchgeführt wurde er am 7. Oktober 1944. „Die Leute küssten sich einfach vor Freude, dass sie den Augenblick erleben sollten, bewusst und ohne Zwang, diesem allem ein Ende machen zu können“, schrieb der polnische Jude Salmen Lewental auf einen Kassiber, den man erst 1962 in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau fand. Sie hätten gewusst, dass sie sterben würden, und seien doch zufrieden gewesen. Dank Frauen wie der jüdischen Kommunistin Lotte Brainin, die Sprengstoff ins Lager schmuggelten, konnten die Aufständischen das Krematorium IV in Brand setzen und damit die stetige Vernichtung – zumindest symbolisch – beschädigen.
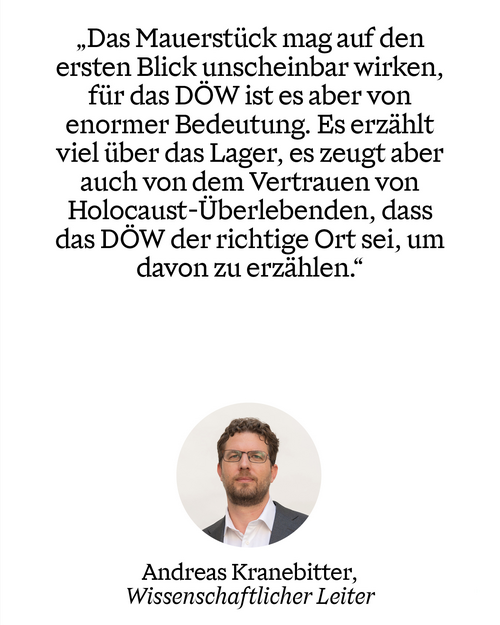
Sie stehen aber auch für das Vertuschen der Spuren der Vernichtung. Denn von November 1944 bis kurz vor der „Evakuierung“ der Deportierten von Auschwitz-Birkenau am 18. Jänner 1945 zu Tausenden ins KZ Mauthausen, befahl die SS wie in anderen Lagern die Beseitigung der Spuren ihrer Vernichtungspolitik. Sie befahl damit auch die Sprengung der Krematorien – nicht ohne zu planen, zwei der fünf Krematorien in Mauthausen wieder aufzubauen. Ein Vorhaben, das die Täter nicht mehr umsetzen konnten.
Der Stein des Krematoriums von Auschwitz-Birkenau steht für all das – und für das Nichts. Als sozusagen selbstverständliches Ausstellungsstück wurde er in der ersten Ausstellung des DÖW lediglich mit dem Beisatz „Mauerstück des gesprengten Krematoriums im KZ Auschwitz-Birkenau“ versehen. Wir wissen offen gesagt nicht, wer den Stein wann genau und wie dem DÖW gebracht hat – für die ehrenamtlich im DÖW arbeitenden KZ-Überlebenden, darunter viele Auschwitz-Überlebende, war es klar, dass sie derartige Gegenstände früher oder später „ihrem“ DÖW übergeben würden. Wir wissen nichts über die konkrete Geschichte, und doch vieles über die vielen Geschichten, die das Mauerstück des Krematoriums von Auschwitz transportiert.
Weiterführende Literatur:
- Tadeusz Borowski, Bei uns in Auschwitz, München 1987.
- Fritz Bauer Institut, Der Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau. Dossier zum 50. Jahrestag des Aufstandes des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau am 7. Oktober 1944. Eingeleitet und zusammengestellt von Werner Renz, Frankfurt/Main 1994.
- Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, Wien 1972.
- Bertrand Perz/Christian Dürr/Ralf Lechner/Robert Vorberg, Die Krematorien von Mauthausen. Katalog zur Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Wien 2008.
- Annegret Schüle, Industrie und Holocaust. Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz, Göttingen 2010.
Autor: Andreas Kranebitter, Wissenschaftlicher Leiter
Fotos: Michael Bigus (Objekt), Daniel Shaked (Porträt)




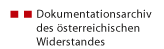


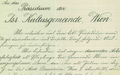


 English
English Termine
Termine Neues
Neues