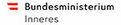Dissertation, Universität Flensburg, 2016 (Abstract)
Diese Arbeit wurde mit dem Herbert-Steiner-Preis 2017 ausgezeichnet.
Im Fokus der eingereichten Arbeit stehen Menschen, die Juden bei der Flucht vor den Deportationen im Nationalsozialismus unterstützt und sie damit vor dem sicheren Tod in einem Ghetto, Arbeits- oder Vernichtungslager bewahrt haben. Schätzungen gehen davon aus, dass auf dem Gebiet des deutschen "Altreichs" – d. h. Deutschlands in den Grenzen von 1937 – mehrere Zehntausend Personen aktiv waren, um Juden ein Überleben in der Illegalität oder die Flucht ins neutrale Ausland zu ermöglichen. Diese Helferinnen und Helfer riskierten ihre Freiheit, ihre Gesundheit und ihr Leben für Personen, die sie oftmals gar nicht kannten. Wie lässt sich ihr Entschluss zur Hilfe erklären? Warum standen diese Menschen den Verfolgten bei, während die Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Verfolgungspolitik hinnahm oder unterstützte?
Seit den 1960er-Jahren haben Studien über Hilfeleistungen für Juden während des Holocaust Antworten auf diese Fragen gesucht. Sie waren eng verbunden mit dem Wunsch nach einem öffentlichen Gedenken und einer pädagogischen Nutzbarmachung der Erfahrungen der Helfer für die Gegenwart. Zahlreiche Publikationen sind im Umfeld von Gedenkstätten und Museen entstanden und haben den Mut der Einzelnen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die vorliegende Arbeit dreht die Perspektive um: Anstelle der besonderen Merkmale einzelner Menschen werden die sozialen Entstehungsbedingungen ihres Handelns in den Blick genommen. Das Phänomen der Hilfe wird zudem im Überblick dargestellt und die Forschungsliteratur systematisch ausgewertet. Die starke moralische Aufladung des Themas soll dadurch für einen Moment zurückgenommen werden, um einer stärker historisierenden Lesart Raum zu geben.
Die Arbeit reiht sich damit in eine Entwicklung ein, die sich seit einigen Jahren auf internationaler Ebene abzeichnet. Der britische Historiker Bob Moore machte bereits 2004 darauf aufmerksam, dass von der Helferforschung allzu oft einzelne Personen und Ereignisse hervorgehoben werden, ohne den Kontext des Geschehens sichtbar zu machen. "Many of the rescuers narratives provide overwhelming evidence of humanitarian responses in the face of great dangers, but often fail to place these actions in the context of where and when they took place", schreibt Moore. (1) Ähnlich argumentieren auch Jacques Sémelin, Claire Andrieu und Sarah Gensburger in ihrem 2008 herausgegebenen Sammelband über Rettungsbemühungen im Kontext von Genoziden. (2) In dem Vorwort zu dem Band appelliert Sémelin an die Forschung, neue, genuin wissenschaftliche Werkzeuge zu entwickeln, um einer Idealisierung des Gegenstandes vorzubeugen: Aus einem Gegenstand der Erinnerung müsse erst noch ein Gegenstand der Geschichte werden. (3)
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stützt sich die vorliegende Arbeit auf das Instrumentarium der Kollektivbiographie – einen Ansatz, der in der Forschung zum Nationalsozialismus und Holocaust bisher vor allem zur Untersuchung von Tätergruppen herangezogen wurde. Das kollektivbiographische Vorgehen basiert auf individuellen Lebensgeschichten, bleibt jedoch nicht bei der Rekonstruktion einzelner Biographien stehen, sondern setzt diese miteinander ins Verhältnis, um vergleichbare Erfahrungen und Strategien sichtbar zu machen. Durch die Arbeit mit einer Auswahl von etwa 50 Fällen und den Abgleich mit den Ergebnissen früherer Studien sollen fallübergreifende, soziale Zusammenhänge aufgezeigt werden, ohne jedoch die Bedeutung der oftmals komplexen und statistisch nicht erfassbaren biographischen Erfahrungen zu vernachlässigen.
Da nur wenige Quellen aus der Zeit des Geschehens überliefert sind, basiert die Helferforschung zu großen Teilen auf lebensgeschichtlichen Interviews, die seit den 1980er-Jahren im Rahmen unterschiedlicher Forschungsprojekte geführt wurden. Hinzu kommen offizielle Dokumente, die nach Kriegsende angelegt wurden, weil ehemals Verfolgte bzw. ihre Unterstützer um eine Eingruppierung als "Opfer des Faschismus" baten, Anträge auf Entschädigungszahlungen stellten oder im Zuge öffentlicher Ehrungen ihre Geschichten zu Protokoll gaben. Unterlagen dieser Art finden sich beispielsweise im Landesarchiv Berlin, bei den Entschädigungsbehörden der Länder und im Bundesarchiv Koblenz.
Die vorliegende Arbeit vertieft das Verständnis der Hilfeleistungen, indem unterschiedliche Analyseebenen miteinander in Bezug gesetzt werden. Die einzelnen Kapitel rücken daher jeweils unterschiedliche Aspekte zur Erklärung des Hilfeverhaltens in den Vordergrund. Sie reichen von langfristigen historischen Entwicklungen über politische Vorerfahrungen und soziologische Faktoren bis hin zu situativen Einflüssen. Die Ergebnisse in Kapitel 6 deuten beispielsweise darauf hin, dass sich Helfer und Helferinnen im "Altreich" überdurchschnittlich oft aus der Alterskohorte der 40- bis 50-Jährigen rekrutierten und häufig der Mittelschicht angehörten. Viele Helfer waren verheiratet, hatten Kinder und arbeiteten als Angestellte, Selbstständige oder kleine Gewerbetreibende. Sie verfügten nicht nur über ausreichend finanzielle Ressourcen, sondern hatten auch die zeitlichen und räumlichen Kapazitäten, die nötig waren, um die Betreuung von Hilfesuchenden mit den eigenen Lebensumständen in Einklang zu bringen.
Ein weiterer Schlüssel zum Verständnis der Hilfeleistungen ist auf biographischer Ebene zu suchen. Kapitel 8 erläutert, dass dem Entschluss zur Hilfe für untergetauchte Juden in vielen Fällen ein längerer Prozess vorausgegangen war, in welchem niedrigschwellige Formen der Solidarität – etwa gegenseitige Besuche, kleine Besorgungen, die Pflege kranker Personen oder die Hilfe bei der Auflösung eines Haushalts – schrittweise eingeübt wurden. Die Helfer entdeckten durch diese frühen Unterstützungsformen Handlungsmöglichkeiten, die ihnen anfangs noch nicht bewusst gewesen waren. An diese Erfahrungen konnten die Helfenden in den 1940er-Jahren anknüpfen, als es darum ging, die Verschleppung in die besetzten polnischen Gebiete zu verhindern. Dem entscheidenden Entschluss zum Verstecken der Verfolgten waren in den meisten Fällen viele dieser kleinen Schritte vorausgegangen. Nur eine kleine Gruppe von Helfern war in der Lage, ohne eine entsprechende "Aufwärmphase" direkt in die Versteckhilfe einzusteigen.
Für den Beginn einer solchen Helferkarriere waren verwandtschaftliche Beziehungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen von zentraler Bedeutung. Die Gruppe der jüdischen Mischehepartner und "Mischlinge" umfasste 1939 noch mindestens 100.000 Personen und damit knapp ein Drittel aller aufgrund ihrer jüdischen Herkunft Verfolgten. Im Unterscheid zu jenen, die vom NS-Regime als sogenannte "Voll-" bzw. "Glaubensjuden" eingestuft worden waren, blieben sie bis zum Kriegsende von den Deportationen und einigen anderen Zwangsmaßnahmen weitgehend verschont. Diese Situation eröffnete Handlungsmöglichkeiten, die die Betroffenen zugunsten anderer Menschen nutzen konnten. Oftmals dienten ihre Wohnungen als Anlaufstellen für untergetauchte Juden, um Informationen über bevorstehende Razzien und Adressen von potenziellen Helfern zu erhalten. Nicht-jüdische Ehepartner schützten nicht nur ihre Nächsten durch die Fortführung der Ehe, sondern unterstützten oftmals auch weitere jüdische Bekannte in der Zeit der Illegalität. Auch die Selbsthilfenetzwerke sogenannter "Mischlinge" fungierten als wichtiges Relais, das zwischen der Welt der Untergetauchten und der übrigen Bevölkerung vermitteln konnte.
Die Hilfe für untergetauchte Juden wurde vom NS-Regime aufmerksam beobachtet und durch die NS-Sicherheitsorgane massiv erschwert. Dennoch blieb die überwiegende Mehrheit der Helfer bis zum Kriegsende von einer Verfolgung verschont. Erstaunlich oft gelang es ihnen, Verdächtigungen aus dem eigenen Umfeld zu entkräften. Die konkreten Folgen einer Entdeckung hingen im hohen Maße von den zuständigen Beamten ab. In manchen Fällen wurden Helferinnen und Helfer jahrelang in Konzentrationslagern oder Zuchthäusern eingesperrt, in anderen kamen sie mit Verwarnungen davon.
Die relativ milde Verfolgung nicht-jüdischer Helfer im "Altreich" kontrastiert deutlich mit der Handhabung gegenüber den beteiligten jüdischen Verfolgten. Sie mussten – egal, ob sie untergetaucht waren oder als Helfer agiert hatten – mit ihrer sofortigen Hinrichtung oder Deportation rechnen. Trotz der vorhandenen Hilfeleistungen gelang es nur etwa 3000 bis 5000 Juden, d. h. etwa einem Viertel aller Untergetauchten, auf dem Gebiet des "Altreichs" zu überleben. (4) Zu massiv war die Verfolgung durch die NS-Behörden, zu verbreitet der Antisemitismus und die Bereitschaft zur Denunziation innerhalb der deutschen Bevölkerung.
Susanne Beer, Sozialwissenschaftlerin, Berlin
<< Herbert-Steiner-Preisträger*innen




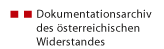





 English
English Termine
Termine Neues
Neues