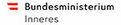Ester Tencer, geb. 1909 als Tochter eines Rabbiners in Galizien, 1914 Übersiedlung nach Wien, Buchhalterin. 1934-1938 illegale Betätigung für eine kommunistische Studentengruppe. Ende Jänner 1939 Belgien. Zugehörigkeit zur "Mädelgruppe" der Kommunistischen Partei, die versuchte, deutsche Soldaten im antinazistischen Sinn zu beeinflussen. März 1943 festgenommen, Jänner 1944 Überstellung in das Sammellager Malines, von dort nach Auschwitz. Ab Anfang 1945 Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, von dort Mitte April 1945 vom Roten Kreuz nach Schweden evakuiert.
Rückkehr nach Wien. Ehrenamtliche Mitarbeiterin des DÖW.
Verstorben 1990.
Ich bin zuerst nach Antwerpen gekommen. Das war so eine Befreiung - frei sein. Man hat überhaupt nicht daran gedacht, dass Belgien einmal besetzt wird, dass der Krieg weitergeht, sondern wir wollten endlich einmal frei sein. Wir haben eine Wohnung gehabt, und mein Bruder hat uns Geld aus den USA geschickt. Arbeiten durfte man ja nicht, also wir haben nicht gearbeitet. Natürlich war ein Komitee [gemeint ist das "Comité d'assistance aux réfugiés juifs", das so genannte "Jüdische Komitee"] dort, das Komitee hat auch zum Teil unterstützt. Ich habe dann gleich Verbindung zur belgischen Partei gesucht. Die Belgier haben zwei kommunistische Parteien gehabt, die Juden haben nicht gemeinsam mit den Belgiern gearbeitet. In Antwerpen war eine sehr große Judengemeinde, und ich habe dann Verbindung bekommen zu dieser jüdischen kommunistischen Partei. Ich habe auch dort gearbeitet, zuerst in einem Kindergarten. Dort habe ich Jiddisch gelernt, so richtig schreiben und lesen. Offiziell war damals die politische Arbeit ja noch legal. Wir haben Zusammenkünfte gehabt, und ich war dann auch in Verbindung mit der österreichischen Partei, und zwar mit der Kommunistischen Jugend von Österreich. [...]
Nach der Besetzung Belgiens durch die Deutschen [am 10. Mai 1940 griff die Deutsche Wehrmacht Belgien an, das am 28. Mai 1940 kapitulierte] hat man mir von der Partei gesagt, ich soll nicht zu Hause wohnen. Meine anderen Schwestern haben sich ja nicht politisch betätigt in Belgien.
Ich habe mir dann in einem Haus ein Zimmer besorgt, und dort habe ich meine illegalen Zeitungen und Flugblätter gedruckt und abgezogen. Geschlafen habe ich schon noch zu Hause. Wir haben dann begonnen, diese Sachen vor den deutschen Kasernen zu verteilen, das heißt hinzuschmeißen. Verteilen konnte man sie ja gar nicht in der illegalen Zeit. [...]
Auch wenn ich in der belgischen jüdischen Partei mitgearbeitet habe, so waren wir doch noch die Gruppe von Österreichern. Die illegale Arbeit haben wir aus Österreich ja schon gekannt. Wir haben dann gleich nach der Besetzung damit begonnen. 1942 setzten die Deportationen in Belgien ein. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, eine Wohnung für meine Mutter und meine zwei Schwestern zu finden, wo sie illegal wohnen konnten. Sie wurden dann leider, im 43er Jahr, von dieser Wohnungsinhaberin anscheinend an einen deutschen Offizier verraten. Ich habe damals nicht mehr bei ihnen gewohnt, ich habe allein bei einer belgischen Familie gewohnt. Ich habe belgische Papiere gehabt, keine österreichischen. Ich habe gut Flämisch gesprochen damals, und ich war offiziell eine Flämin mit einer deutschen Mutter und mit einem flämischen Vater. Meine Mutter und meine Schwestern wurden Ende Februar 1943 abgeführt. Da hatte ich noch eine Karte erhalten, die sie unterwegs weggeschmissen haben und die ich dann bekommen habe, wo sie schreiben: "Wir fahren in ein Lager, wir wissen nicht, wohin." Das war das letzte Lebenszeichen, das ich von ihnen bekommen habe. Vermutlich sind sie in ein Vernichtungslager gekommen. Es sind damals die ganzen Transporte mit den Juden in den Osten gegangen. Meine Schwestern sind bestimmt mit der Mutter gegangen. Meine Mutter war damals schon 55 Jahre alt, schon ein alter Mensch, und sie sind sicher ins Gas gegangen. Ich meine, ich habe nie ein Lebenszeichen mehr bekommen. Es sind ja keine Listen geführt worden von den Leuten, die gleich ins Gas gegangen sind. Die Karte war das Letzte, was ich bekommen habe. Einen Monat später bin ich dann ja selber hochgegangen. [...]
Bevor wir diese Soldatenarbeit begonnen haben, hatten wir eine Besprechung mit den Genossen, dass wir diese Arbeit machen. Die Vorsichtsmaßnahmen waren natürlich sehr schwer genau festzulegen. Wir haben nur abgesprochen, dass man, wenn man "aufreißen" geht, so hat man das genannt, kein Material bei sich haben soll. Sondern erst, wenn man dem Soldaten irgendwie das Vertrauen gibt, vereinbart man mit ihm einen zweiten Treff. Dann kann man ihm Flugblätter oder Zeitungen bringen. Wir haben uns natürlich an diese Vorsichtsmaßnahmen gehalten. Doch war das so - bitte, vielleicht war das auch der Fehler der Partei an sich -, dass man uns gesagt hat, wir sollen nicht zu lange mit den Soldaten gehen. Weil das war ja nicht so, dass wir sie angesprochen haben. An und für sich haben wir uns hergerichtet und sind genauso wie die Strichmädchen am Strich gegangen. Das heißt, wir sind dort hingegangen, wo wir gewusst haben, dass die Soldaten spazieren gehen und "aufreißen". Da haben wir uns natürlich dementsprechend hergerichtet und haben uns von den Soldaten ansprechen lassen, wie man das so macht. Wenn sie uns angesprochen haben, dann haben wir versucht, nicht mit ihnen, wie sie ja gedacht haben, schlafen zu gehen, sondern zuerst einmal zu sprechen. Vor allem war das für uns leichter. Die belgischen Genossinnen haben ja die Arbeit nicht gemacht, sondern nur die Österreicherinnen haben die Arbeit gemacht. Weil wir Deutsch sprechen konnten, die Soldaten haben ja weder Französisch noch Flämisch gesprochen und verstanden. Da wir Deutsch gesprochen haben, so war das der erste Anknüpfungspunkt, dass sie uns gefragt haben: "Ja, wieso sprechen Sie als Belgierin Deutsch?" Da haben wir gesagt, die Mutter war Deutsche, der Vater war Belgier, und zu Hause wurde auch Deutsch gesprochen, deswegen sprechen wir gut Deutsch. Dadurch war natürlich die Möglichkeit, sich mit dem Soldaten zu unterhalten, ohne mit ihm schlafen zu gehen, viel stärker als wenn sie, sagen wir, eine Belgierin wirklich angesprochen hätte, die ja kein Wort Deutsch konnte. Wir haben das natürlich, man muss sagen, nach Gefühl gemacht, auch danach, wie der Soldat reagiert hat auf die Frage, dass wir Deutsch sprechen. Irgendwie hat man dann begonnen, über den Krieg und über die schlechte Ernährungslage zu sprechen. Das war der erste Anhaltspunkt, wenn man sagen konnte: "Ich habe kein Essen, wir müssen hungern, und wir haben gar nichts." So ist man in das Gespräch hineingekommen, weiter zum Krieg, warum man kein Essen hat, warum in Belgien, wo wir früher so viel und alles gehabt haben, jetzt gar nichts da ist. Und je nachdem, wie der Soldat darauf reagiert hat, hat man dann gleich einmal gesagt: "Na, schlafen gehen tun wir nicht. Wir können uns nächstens wieder einmal treffen." [...] Wenn er darauf eingestiegen ist, so hat man ihm das nächste Mal Material gebracht und hat dann versucht, ihm zu sagen - dann war man schon ziemlich offen -, dass man gegen den Krieg ist und dass man gegen den Krieg arbeitet, und wenn er bereit ist, das Material mit in die Kaserne zu nehmen, wo wir ja nicht hineingehen können, ob er es dort verteilen kann und so weiter. So war die Verbindung. Es hat natürlich nicht sehr viele solche Gruppen gegeben. [...]
In der Partei war dann eine Diskussion über die Frage, ob es sich gelohnt hat im Verhältnis zu den Erfolgen, die man gehabt hat, denn die Erfolge waren eher gering. Weil auch diese Gruppe nicht viel hat machen können. Sie haben wohl Zeitungen verteilt innerhalb der Kaserne, aber den Krieg an und für sich haben sie bestimmt nicht so stark beeinflusst, dass er rascher zu Ende gegangen ist, während fast alle Kameradinnen, die die Arbeit gemacht haben, hochgegangen sind. [...]
Was wir nicht gewusst haben war, dass die Armee wirklich so stark ist und dass die Soldaten, weil sie eben so lang und so schnell gesiegt haben, so fest daran gehalten haben und mitgegangen sind mit dem ganzen Hitlerismus. Ich glaube, dass wir uns dessen nicht ganz bewusst waren, und dadurch haben wir geglaubt, dass wir einen Teil dazu beitragen, dass der Krieg rascher fertig ist. Diese Übersicht haben wir nicht gehabt, und die hat die Partei wahrscheinlich auch nicht gehabt. Sondern man hat einfach gesagt: "Was können wir machen? Was können wir in dieser Zeit machen?" Ein Teil hat natürlich die eigentliche Partisanenarbeit gemacht, also mit der Waffe in der Hand und Sabotage, wo die Möglichkeit war, und wir, die Mädchen, haben die Soldatenarbeit gemacht. Da haben wir gesagt, das sind auch Sabotagearbeiten. Wir versuchen, die Soldaten zu demoralisieren oder ihnen nachzuweisen, dass der Krieg sowieso verloren wird, und sie werden gar nichts davon haben. [...]
Bevor ich hochgegangen bin, hatte ich schon eine gute Gruppe. Ich hatte fünf oder sechs Soldaten, zum Teil die, die in der Kommandantur gearbeitet haben. Ich habe natürlich immer weiter versucht "aufzureißen" und habe im Frühjahr 1943 zwei Soldaten kennen gelernt, von denen ich hundertprozentig überzeugt war, dass sie gut sind. Wir haben für den nächsten Tag vereinbart, dass ich ihnen Zeitungen und Flugblätter bringe, aber ich sollte in die Kaserne kommen. Sie würden drinnen das Material verteilen. Das war ja die Aufgabe, dass die Soldaten Material sowohl ins Feld hinein und nach Hause nehmen, wenn sie auf Urlaub gehen, oder dass sie schauen, dass sie es dort illegal verteilen. Mir sind die beiden sehr gut erschienen. Ich blöde Gans gehe mit dem Material, obwohl wir das eigentlich verboten haben, dass man in die Kaserne hineingeht mit Material, in die Kaserne hinein, setze mich zum Tisch hin, und kaum sitzen wir, da ist die Deutsche Feldgendarmerie da und verhaftet mich mit dem gesamten Material. [...]
Ich bin jeden Tag in der Früh zum Verhör auf die Kommandantur geführt worden. In der Früh um acht haben sie mich abgeholt mit einem Wagen. Wir sind so durch einen Park durchgefahren, und die Leute sind da auf der Bank gesessen, und es war ja Frühling, der Sommer ist gekommen. "Einmal noch auf so einer Bank sitzen", habe ich mir immer gedacht.
In den ersten Tagen haben sie mir eine Hure in die Zelle hineingesetzt. Das haben wir aber schon gewusst, dass, falls man hochgeht, man nichts bekannt gibt und mit Leuten, die zu einem hereingesetzt werden, nicht spricht. Ich hatte einen Wintermantel an, es war ja März, und bin sehr geschlagen worden auf der Kommandantur, weil ich meine Adresse nicht hergeben wollte. Ich habe gesagt, ich wohne jeden Tag woanders. Jetzt komme ich ins Gefängnis, ich habe mich nicht ausgezogen, ich bin so dagesessen, und da sitzt die Hure und die fragt mich aus. "Warum sind Sie da? Sie schauen ja gar nicht wie ein Straßenmädel aus." Sagte ich: "Ich bin es aber trotzdem." Das war der einfachste Ausweg. Dann hat sie keinen Grund mehr, mich auszufragen, weil ich bin genauso wie sie. Dann hat sie keinen Grund, besonders neugierig zu sein. Dann war es aus, am nächsten Tag haben sie sie rausgenommen. Ich bin fast ein ganzes Jahr allein in einer Zelle gesessen, fast ein Jahr, bis zum Jänner 1944. [...]
Zum Schluss hat es geheißen, die Verhandlung ist abgeschlossen, also haben sie mich nicht mehr geholt. Ich musste nur noch auf mein Urteil warten. Und ich habe gewartet und gewartet, und ich war mir ganz sicher, dass ich zum Tode verurteilt werde, nachdem ich ja nichts geleugnet habe, das war ja ein reiner Fall. [...]
Ich habe auch gar nicht versucht zu leugnen, weil das wäre ja sinnlos gewesen. Ich habe nur gesagt: "Das habe ich gefunden, das habe ich genommen, weil ich gegen die Deutschen und den Krieg bin und das verteilen wollte." Ganz einfach. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren gehabt, ich brauchte ja nichts mehr zu sagen. "Und meine Adresse gebe ich nicht an, ich habe immer woanders gewohnt, ich habe keine Adresse. Und es hat mir niemand die Zeitung gegeben, die habe ich gefunden, und ich habe sie gelesen, da ich Deutsch lesen kann, mein Vater war ja Deutscher und meine Mutter Belgierin. Also habe ich das verteilt. Und ich bin als Belgierin gegen die Deutschen und gegen den Krieg." Was hätten die machen sollen? [...]
Aber wie ich das gewusst habe, dass ich mit dem Todesurteil rechnen muss, und wie man mich nicht mehr zum Verhör geholt hat, das waren schon schreckliche Tage. Da habe ich immer in der Nacht geträumt, dass ich zum Erschießen abgeholt werde. Das war schon sehr arg. Bis dann eines Tages wer gekommen ist und gesagt hat: "Also der Prozess ist aus, Sie sind zu 'Nacht und Nebel' verurteilt, und Sie kommen nach Malines und von dort dann ins Lager." ["Nacht und Nebel" verhieß als besonderen Systemgegnern eingestuften Häftlingen den Tod binnen 3 Monaten in NS-Konzentrationslagern. Die Parole bezieht sich auf einen Ausspruch Hitlers, jeder, der sich ihm in den Weg stelle, werden ohne Spuren in Nacht und Nebel untergehen.] Malines war das Auffanglager für die Juden, die man von dort dann nach Auschwitz gebracht hat.




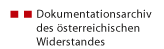











 English
English Termine
Termine Neues
Neues