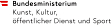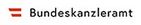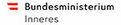„Wir brauchen diesen Bericht. Wir brauchen klare und detaillierte Analysen – und das bietet dieser Bericht an. Er zeigt, wie rechtsextreme Ideologien wirken, wie sie sich verbreiten. Er deckt die Akteure, die Aktivitäten, ihre Publikationen und ihre Netzwerke auf – und aber auch ihre internationalen Verbindungen.“ Justizministerin Anna Sporrer legte den Rechtsextremismus-Bericht am 25. April im Nationalratsplenum vor. Der Bericht von Justiz- und Innenministerium, in deren Auftrag vom DÖW verfasst, stand als Punkt 9 auf der Tagesordnung der Nationalratssitzung.
Lob und Kritik
Neben der Ministerin meldeten sich je zwei Abgeordneten der im Parlament vertretenen Parteien zu Wort. Fast einhellig fielen der Dank an das DÖW für die Erstellung des Berichts beziehungsweise die Betonung der Gefahr rechtsextremer Ideologie und Aktivitäten aus. Die Abgeordneten der FPÖ kritisierten den Bericht, Harald Stefan bemängelte etwa einen zu breiten Rechtsextremismusbegriff und wiederholte gerichtsanhängige Vorwürfe an das DÖW (Zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen siehe etwa Fabian Schmids Artikel im Standard – zum Artikel). Im darauffolgenden Redebeitrag, in dem sie die Bedeutung der Wiedereinführung des Rechtsextremismus-Berichts betonte, adressierte SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz direkt die FPÖ: „Ich bin froh, dass Herr Kickl in den Regierungsverhandlungen gescheitert ist, dass es nicht gelungen ist, den Rechtsextremismus-Bericht wieder abzudrehen, dass es nicht gelungen ist, das Dokumentationsarchiv und die Zusammenarbeit mit ihm abzudrehen, und dass sich diese Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS zum Ziel gesetzt hat, den Rechtsextremismus-Bericht jedes Jahr erscheinen zu lassen, zu veröffentlichen und einen Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus auf den Weg zu bringen.“
Sprache im Zentrum
Anschließend sprach Markus Leinfellner von der FPÖ über die Verurteilungsstatistiken aus dem Bericht und die Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, bei denen er die Teilnahme von Rechtsextremen nicht beobachtet habe. ÖVP-Abgeordnete Johanna Jachs sprach davon, dass sie jeglichen Extremismus ablehne: „Was genau rechtsextrem ist oder was linksextrem ist, ist schlussendlich eine politische Bewertung, eine politische Perspektive, und für uns als Bürgerliche sind beide Extreme gleichermaßen bedeutend.“ NEOS-Abgeordnete Sophie Marie Wotschke hob – auch anlässlich des am Tag zuvor vom FPÖ-Abgeordneten Peter Wurm verwendeten Begriffs „Umvolkung“ – die Bedeutung von Sprache hervor. In Richtung der FPÖ-Abgeordneten sagte sie: „Sie spalten ganz, ganz bewusst, Sie spielen Menschengruppen gegeneinander aus, und Sie wissen ganz genau, was die Bedeutung der Sprache ist. Sie wissen, was die Sprache macht, und Sie wissen, dass auf Sprache auch immer Taten folgen.“
Der Grünen-Abgeordnete Ralph Schallmeiner widmete sich in seinem Redebeitrag speziell rechtsextremen Medien wie AUF1 und derstatus.at, deren Verschwörungstheorien sowie personellen Überschneidungen zur FPÖ. „Auch das belegt dieser Bericht, und deswegen ist es auch so wichtig, dass dieser Bericht genau dort hinschaut“, sagte er zum Abschluss seines Redebeitrags. „Denn da geht es um ganz konkrete Bedrohungen für unsere Demokratie, für die demokratischen Institutionen, um ganz konkrete Bedrohungen für die liberale Demokratie, in der wir leben.“ Antonio Della Rossa von der SPÖ nahm den Bericht als „lauten Einspruch gegen das Verstummen“ wahr. „Wir brauchen Transparenz, Forschung und Mut zur Wahrheit, denn Demokratie verteidigt sich nicht durch Schweigen, Demokratie verteidigt sich durch Wissen, Sprache und Haltung“, sagte er.

DÖW-Leiter Andreas Kranebitter beim Antrittsbesuch bei Justizministerin Anna Sporrer (Foto: BMJ)
Einladung zum Austausch
Auch Wolfgang Gerstl von der ÖVP warnte vor einem Erstarken des Rechtsextremismus „Es gibt nicht nur als rechtsextremistisch klassifizierte Tathandlungen wie Körperverletzung und gefährliche Drohung oder Sachbeschädigung, […] sondern auch einen Mord, einen räuberischen Diebstahl, Brandstiftung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und natürlich – ‚natürlich‘, Entschuldigung!, nein, es darf nicht natürlich sein –, und zahlreiche Handlungen, die als nationalsozialistische Wiederbetätigung zur Verantwortung gezogen wurden. Meine Damen und Herren, das hat mich betroffen gemacht“, sagte er. Er schloss seinen Beitrag mit dem Vorschlag, die Autor*innen des Berichts zum gemeinsamen Austausch einzuladen, um den Bericht noch besser zu machen. Er spielte damit auf die Diskussionen über die Klassifizierung und Einordnung einzelner Vorfälle aus dem rechtskatholischen Milieu im Bericht an. (Mit dieser Thematik befasste sich Heinz Niederleitner auch in der Kirchenzeitung, in dem Artikel klärt DÖW-Projektleiter Bernhard Weidinger einige Missverständnisse auf – zum Artikel)
Grünen-Abgeordneter Lukas Hammer schloss seine Rede mit einem Aufruf: „Dieser Bericht ist für den demokratischen Teil dieses Hauses ein Auftrag, und zwar: Sich mit aller Entschlossenheit jeder Ausformung des Rechtsextremismus entgegenzustellen und tatsächlich Lösungen für Probleme anzubieten, anstatt die Diskurse der extremen Rechten zu übernehmen.“ Yannick Shetty von den NEOS nahm im letzten Redebeitrag zu dem Tagesordnungspunkt auf einen Zwischenruf von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl Bezug, den er zu einer Wortmeldung aufforderte: „Wenn Sie der Meinung sind, dass das ein Begriff [‚Umvolkung‘, Anm.] ist, den Sie politisch verwenden wollen, dann stellen Sie sich hier heraus und zeigen Sie den Wählerinnen und Wählern Ihr wahres Gesicht – aber nicht A sagen und dann B machen.“
Nach Ende der Debatte wurde der Bericht mit Zustimmung der Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne zur Kenntnis genommen.
Reaktion des DÖW
Das DÖW begrüßt, dass der Rechtsextremismus-Bericht breiten Raum im Parlament eingenommen hat. Wir begrüßen es ebenfalls, dass zahlreiche Abgeordnete aus unterschiedlichsten Fraktionen auf die Gefahren des Rechtsextremismus hingewiesen haben. Unsere Rechtsextremismusforscher*innen arbeiten bereits gemeinsam mit externen Expert*innen an dem Bericht für das Jahr 2024, dabei werden wir konstruktive Kritik gerne berücksichtigen. Selbstverständlich werden wir auch diesen Bericht unabhängig und nach allen wissenschaftlichen Standards verfassen und darin auf alle Formen und Vorformen des Rechtsextremismus hinweisen.
Weiterführende Hinweise




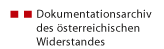


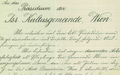


 English
English Termine
Termine Neues
Neues