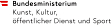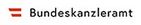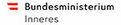Sehr geehrte Frau Abgeordnete, liebe Sabine,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Frau Hackl, liebe Frau Wadani, liebe Freundinnen und Freunde!
Die nationalsozialistische Machtergreifung begann in gewisser Weise mit der Eroberung der Sprache, mit der Besetzung der Wörter. „Schutzhaft“ „Volkskanzler“, „Volksgemeinschaft“, „Volksschädling“, „Umvolkung“ – das sind nur einige der bekanntesten Beispiele für Begriffe, die der Nationalsozialismus erfunden oder umgeprägt hat. Die Brutalisierung der Sprache zog sich bis zum Ende der NS-Herrschaft, bis zu den sogenannten Endphaseverbrechen. Hier im Mühlviertel gab es einen besonderen Begriff, mit dem NS-Verbrechen sprachlich verniedlicht wurden und mit dem dessen Opfer abgewertet und entmenschlicht wurden – den Begriff der „Hasenjagd“, der „Mühlviertler Hasenjagd“. So nannte die SS die Hetzjagd auf knapp 500 geflohene KZ-Häftlinge, die in der Nacht zum 2. Februar 1945 aus dem KZ Mauthausen ausbrachen. Nur elf Menschen haben überlebt, alle anderen wurden ermordet – von der SS, von Wehrmachtssoldaten, von Gendarmerie-Beamten, von HJ- und Volkssturm-Mitgliedern – und von Zivilisten, die aufgefordert wurden, sich am Massenmord zu beteiligen. Viel zu viele schlossen sich diesem Aufruf an.
Ich möchte zuallererst den Opfern dieser Menschenhatz – die Überlebenden nannten sie Blutrausch – gedenken, von ihrem Schicksal erzählen. Die SS bezeichnete sie als „K-Häftlinge“, „Kugel-Häftlinge“. Die meisten von ihnen, neben vereinzelten polnischen, niederländischen und jugoslawischen Deportierten, waren sowjetische Kriegsgefangene, die als „jüdische Bolschewiken“ zum gleich mehrfachen Feindbild gemacht wurden. Als Angehörige der Roten Armee überstellte sie die angeblich „saubere“ Wehrmacht zur Exekution ins KZ Mauthausen. Dort wurden sie erschossen oder im Todesblock 20 dem Verhungern überlassen, weil man in der „Aktion Kugel“ noch die Kugel für ihre Erschießung sparen wollte. Dem sicheren Tod im Lager zogen diese Gefangenen im Februar 1945 die Flucht vor, in dieser einzigartigen Widerstandsaktion flohen sie sternförmig in Richtung Norden, in Richtung der besetzten Tschechoslowakei, von deren Bevölkerung sie sich mehr Unterstützung erwarteten als von jener in der Umgebung des KZ Mauthausen. „Wenn ich mich daran erinnere“, schrieb einer der Überlebenden, Viktor Ukrainzew, der einen nach dem anderen seiner Mitgeflohenen sterben sehen musste, „so wird mir heute noch heiß und kalt. Da ich allein geblieben bin, habe ich mich nicht mehr getraut, in irgendwelche Orte, Häuser aufzusuchen, und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich von Baumrinde, Moos, erfrorenen Vögeln zu ernähren“. Alle Überlebenden überlebten nur durch großes Glück.
Wer von den Opfern spricht, muss aber auch von den Tätern und vom System des Terrors reden: Am 5. Mai 1945, vor 80 Jahren, wurden in Mauthausen und Gusen rund 40.000 Menschen befreit. Mit dieser Zahl wäre der KZ-Komplex damals die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs gewesen. Die Dimensionen werden aber noch erschreckender, wenn man auf die gesamte Bestehensdauer des Lagers blickt: 190.000 Inhaftierte wurden nach Mauthausen deportiert, 90.000 Menschen wurden zwischen 1938 und 1945 hier ermordet. Bei derartigen Dimensionen ist völlig klar, dass der Lagerbetrieb nicht im Versteckten stattfand, sondern in aller Offenheit – vor den Augen aller. Zehntausende waren an diesem System beteiligt, als Kommandanturangehörige, Wachen, Zulieferer von Wirtschaftsgütern. Auch das zeigt die Geschichte der Mühlviertler Menschenhatz – die Einbeziehung vieler in die NS-Verbrechen. Der Historiker Peter Kammerstätter ging Anfang der 1970er Jahre durch die Ortschaften und befragte verschiedene frühere Augenzeugen. Viele Menschen erinnerten sich gut und gaben bereitwillig Auskunft. In Marbach erzählten zwei Anwohner von einem Malermeister, der zufällig im Ort war. „Malermeister Holzhaider ist zufällig beim Bauer Sey vorbeigekommen. Bei diesem Bauern hat sich ein KZler versteckt, sie haben ihn gefunden und herausgeholt. Der Häftling hat gebeten, ihm nichts zu tun, er hat auch zuhause Familie. Holzhaider hat einen Sauschlögel geholt und ihn damit erschlagen. Im Gasthaus hat er sich gebrüstet, ich habe einem das Licht ausgeblasen.“

DÖW-Leiter Andreas Kranebitter bei der Gedenkrede in Ried in der Riedmark
Foto: Roland Langthaler
Kammerstätters Buch ist voll von Geschichten wie diesen. Die Mühlviertler Menschenhatz dient also auch dazu, um über die Rolle der Zivilbevölkerung in der NS-Zeit zu reflektieren. Der Ausbruch und die Aufrufe der SS haben sie zu einer Reaktion gezwungen, die vollkommen unterschiedlich ausfällt. Einige machen mit – sie beteiligen sich an den Ermordungen und tragen Mitverantwortung an den Verbrechen. Dann gibt es die große Mehrheit derjenigen, die wegschauen, untätig bleiben. Und es gibt ein paar – wenige –, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus leisten, indem sie Geflüchtete verstecken und versorgen. Eine davon war die Familie von Maria Langthaler und Anna Hackl – sie erzählte dem Filmemacher Andreas Gruber in einem Interview, dass jemand an die Tür geklopft und sich als Dolmetscher vorgestellt habe. „Die Mutter hat ihn bei der Hand genommen und hat gesagt: ‚Komm, ich weiß schon, wer du bist.‘ Man hat es aus der Presse gewußt. Sie hat ihn in die Küche geführt und gesagt: ‚Ich habe auch fünf Söhne im Krieg und will, dass meine Söhne alle nach Hause kommen. Du hast auch eine Mutter, die will, dass ihr Sohn nach Hause kommt.‘ Dieser Widerstand ist lange nicht als solcher erkannt worden. Das liegt daran, dass ein großer Teil Nachkriegsösterreichs Widerstand als Verrat betrachtete, das liegt aber auch daran, dass dieser alltägliche Widerstand nicht einem ideologischen Motiv entsprungen ist, sondern einfach „nur“ als Menschlichkeit galt.
Die Mühlviertler Menschenhatz endet nicht mit der Befreiung. Sie schreibt sich fest in den Alltag und die Geschichte dieser Region ein. Das Thema ist nach 1945 das öffentliche Schweigen darüber. Privat wird natürlich gewusst, wer sich beteiligt hat, wer weggeschaut hat, wer vielleicht etwas dagegen unternommen hat. Es ist ein Wissen, das über Generationen weitergegeben wird – öffentlich wird es deswegen aber noch lange nicht. Es an die Oberfläche gebracht zu haben, dabei auch auf die Widerstände der anderen gestoßen zu sein, ist wieder das Verdienst von wenigen.
Und damit möchte ich – Peter Kammerstätter habe ich schon erwähnt – auf Andreas Gruber zu sprechen kommen, der vor einem Jahr hier die Gedenkrede gehalten hat. Er hat mit seinem Spielfilm über die Ereignisse Räume geöffnet, um über das Geschehene zu sprechen. Auch für mich, damals Jugendlicher, hat der Film eine nicht wegzudenkende Bedeutung. Ich erinnere mich gut daran, als der Film Mitte der 1990er Jahre erstmals im Fernsehen lief, nach langem Hin und Her an einem Samstag im Hauptabendprogramm. Statt diesen Samstagabend mit Freunden zu verbringen, bin ich ausnahmsweise zu Hause geblieben. Es hat sich ausgezahlt, es hat mich nachhaltig geprägt. Andreas Gruber hat seinen Film auf Englisch „The Quality of Mercy“ genannt und wie ich finde zurecht gemeint, dass dieser Titel eigentlich besser passe als der deutsche, „Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen“. „The Quality of Mercy“, eine Anspielung auf Shakespeare, meint vor allem eines – nämlich die Seltenheit des richtigen und guten Verhaltens, der Humanität, des Widerstands, der Hilfe für Schwache und Ausgegrenzte. Der deutsche Titel fokussiert auf die schweigende Mehrheit, der englische meint die widerständige Minderheit, die das richtige tut.
Eine Minderheit macht aus, dass ihr eine Mehrheit gegenübersteht. Es war auch Jahrzehnte später eine Minderheit, die dafür gekämpft hat, dass das öffentliche Schweigen gebrochen wird. Es waren Personen wie Kammerstätter, Gruber, und Aktivist*innen wie du, liebe Sabine, die gemeinsam mit Mitstreiter*innen dafür gekämpft hat, dass hier an diesem Ort, der während der Verbrechen von 1945 eine Art Stützpunkt war, nun seit 2001 eine Gedenktafel an die Opfer erinnert. Es waren aktive Minderheiten, deren Engagement Dinge mehrheitsfähig gemacht haben. Und wenn die Feier in Ried in der Riedmark im Anschluss an die Befreiungsfeier zur Routine geworden ist, zeigt das, wie sich Stimmungen und Mehrheitsverhältnisse drehen können.
Wir kommen gerade von einer Gedenkveranstaltung mit 20.000 Teilnehmer*innen – wenn man die Befreiungsfeiern über die Jahrzehnte betrachtet, ist es ist schön zu sehen, wie zentral die Erinnerungskultur seit geraumer Zeit geworden ist. Wie aus einer Minderheit, die das richtige tut, eine Mehrheit wird.
Und als Vertreter des DÖW weiß ich, wovon ich spreche, denn auch unsere Institution wurde vor über 60 Jahren im postfaschistischen Österreich gewissermaßen aus Notwehr gegründet. Wir haben gesammelt, weil sonst niemand gesammelt hätte, wir haben geforscht, weil sonst niemand geforscht hätte, wir haben dort hingeschaut, wo andere lieber weggeschaut haben, weil der Blick wehtat und die Wunde offen war. Was das damals, vor 60 Jahren bedeutet hat, illustriert die Geschichte einer Grazer Buchhandlung, die berichtet hat, dass sie ein Buch zum Nationalsozialismus nicht in der Auslage stehen lassen hätte können, ohne Gefahr zu laufen, dass die Schaufensterscheibe eingeschlagen würde.
Ich habe davon gesprochen, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Erinnerungskultur so breit wie möglich anzulegen, Minderheitenmeinungen zu jenen der Mehrheit werden zu lassen, ganz im klassisch universalistischen Sinn die Aufklärung aller anzustreben. Wir dürfen aber nicht naiv universalistisch sein. Wir wissen, dass nicht alle an unserer Art des Gedenkens teilnehmen wollen oder nur vorgeben, teilnehmen zu wollen, um sich weißzuwaschen.
Es hat in Österreich immer schon einen bewussten rechtsextremen Geschichtsdiskurs gegeben – etwa wenn Jörg Haider bei den sogenannten Ulrichsbergtreffen die dortigen ehemaligen Wehrmachts- und SS-Angehörigen wortwörtlich als Opfer des Kriegs und als „anständige Menschen“ bezeichnete, „die einen Charakter haben und die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stehen und ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind“. Hinter diesem bewussten Rechtsextremismus steht aber eine Art unbewusster Rechtsextremismus, der heute wieder weiter verbreitet ist. Er zeigt sich gerade in seinem Verhältnis zur Vergangenheit. Und er wird lauter, wenn in Umfragen wie unserem Rechtsextremismus-Barometer mittlerweile 42 Prozent der österreichischen Bevölkerung der Aussage zustimmen, dass „die Diskussion über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust beendet werden soll“. Die gegenseitige Verstärkung von bewusstem und unbewusstem Rechtsextremismus ist ein aktuelles und akutes Problem, das wir ansprechen müssen, das wir hier problematisieren müssen.
Rechtsextremismus ist unfähig, zu trauern, er ist unwillig, sich kritisch mit Geschichte auseinanderzusetzen. Denn er sucht in der Geschichte nur nach Orientierung, nach Sicherheit, nach einer natürlichen Identität des Volkes. Er leugnet die NS-Verbrechen und tut sie als „Vogelschiss in der Geschichte“ ab, er wehrt kritische Geschichtsbetrachtung und all jene ab, die sie leisten, er diffamiert Gedenktage wie den heutigen als „Schuldkult“. Mit Rechtsextremen zu gedenken, wäre also absurd.
Es gibt Grenzen des gemeinsamen Gedenkens. Sich selbst und die eigenen Ziele ernstzunehmen, heißt also auch, diese Grenzen zu setzen, auf ihnen zu beharren und sie nicht aufzuweichen. Manche von ihnen können etwa den Namen Walter Rosenkranz nicht mehr hören. Aber er steht stellvertretend für viele und interessiert mich nicht als Person, sondern in seiner Funktion. Denn er ist der zweithöchste Amtsträger unserer Republik, der Präsident des Nationalrats und immer noch Vorsitzende des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus. Ein schlagender Burschenschafter, der noch vor wenigen Jahren überzeugte Nationalsozialisten, nationalsozialistische Verbrecher wie den Generalstaatsanwalt Johann Karl Stich und den Wiener Polizeipräsidenten Otto Steinhäusl als „Leistungsträger in Österreich zwischen 1918 und 1938“ bezeichnet hat. Jemand, der immer noch kein schlechtes Wort über seinen Büroleiter verlieren wollte, obwohl dieser Kontakt mit Rechtsextremen hatte und in dessen Hauptwohnsitz Waffen für den „Tag X“, den rechtsextremen Aufstand, gefunden wurden. Jemand, der keinen Ordnungsruf erteilt, wenn ein Abgeordneter seiner Fraktion den NS-Begriff „Umvolkung“ positiv verwendet und dem nicht auffällt, dass auf seiner eigenen Facebook-Seite hunderte antisemitische Hetzkommentare gepostet werden.
Es kann mit Organisationen und Personen dieser Gesinnung kein gemeinsames Gedenken geben. Und ich glaube sagen zu können, nur das Aufzeigen dieser Grenzen, das Drücken der Stopp-Taste durch Institutionen wie das DÖW, unsere Freund*innen vom MKÖ, von der IKG und vielen anderen sorgen dafür, dass keine Gewöhnung eintritt, dass keine Normalisierung eintritt. Gedenken heißt für mich, breite Allianzen zu schmieden, Unterschiede anzuerkennen, aufeinander zuzugehen und Gemeinsamkeiten zu finden. Es heißt aber auch, klare Grenzen zu ziehen – und sich ihrer bewusst zu sein. Die kompromisslose Ablehnung von Faschismus und Rechtsextremismus ist die Bedingung einer demokratischen Kompromisskultur.
Nur das „Immer Wieder“ unserer Erinnerns, von Gedenkveranstaltungen wie den heutigen, kann das „Nie Wieder“ absichern. In diesem Sinne, liebe Gäste, fühle ich mich geehrt, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, dass ich heute mit Ihnen gemeinsam gedenken darf. Erinnern wir gemeinsam an die Toten der Menschenhatz vor 80 Jahren. Erzählen wir die ganze Geschichte, erzählen wir von denen, die sich an Verbrechen beteiligt haben, von denen, die weggeschaut haben, und von denen, die Widerstand geleistet haben. Und nehmen wir die Erinnerung auch als Auftrag wahr.
Auch wenn der Gegenwind gegen das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wieder größer scheint, ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, beharrlich weiterzumachen. Nicht mit der Meute zu heulen, sondern eigene Gedanken zu formen. Nicht naiv die Falschen weißzuwaschen, sondern das richtige Gedenken hochzuhalten.
Vielen Dank.

Andreas Kranebitter und Anna Hackl
Foto: Victor Kössl
<< Weitere Beiträge aus der Rubrik „Neues“




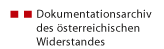


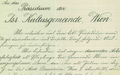


 English
English Termine
Termine Neues
Neues