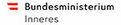Franzi (Danneberg-)Löw, geb. 1916 in Wien. Ab September 1937 Fürsorgerin der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. 1938-1945 Betreuung von jüdischen Jugendlichen, Gefangenen und ungarischen Jüdinnen und Juden.
1945 trat Franzi (Danneberg-)Löw in den Dienst der Stadt Wien.
Verstorben.
Ab November 1938 war ich in der Fürsorgezentrale der Israelitischen Kultusgemeinde, Wien 1., Seitenstettengasse 2-4, beschäftigt. Ab diesem Zeitpunkt hat eigentlich meine richtige Fürsorgearbeit begonnen. Ich arbeitete endlich in der Jugendfürsorge.
Es ist die schreckliche "Kristallnacht" vorangegangen, ich musste mich um die Frauen und die Kinder kümmern, deren Männer und Väter in den Gefangenenhäusern gesessen oder in die verschiedenen Konzentrationslager gekommen sind. Die Mütter standen plötzlich ohne Einkommen da und bekamen von der Israelitischen Kultusgemeinde geldliche Unterstützung. Außerdem kümmerten wir uns um deren Kinder, indem wir sie in der Kindertagesheimstätte unterbrachten.
Die Leitung der gesamten Fürsorge hatte Frau Rosl Schwarz [1940 nach Palästina geflüchtet], die der Jugendfürsorge Frau Lily Reichenfeld inne. Frau Reichenfeld war es, die mir anfangs meine Arbeit zuteilte. Ich hatte einen großen Sprengel, nämlich die Wiener Stadtbezirke 1 bis 21, zu betreuen, und dazu noch die Aufsicht über die jüdischen Jugendheime. Ich machte also vormittags Parteienverkehr, nachmittags Hausbesuche, und in den Abendstunden war ich in den verschiedenen Jugendheimen mit den Kindern beim Abendessen, Waschen, Gute-Nacht-Sagen zusammen.
Im Jahre 1942 ist Frau Lily Reichenfeld, die zu dieser Zeit die Gesamtleitung der Fürsorge übernommen hatte, "evakuiert" worden. Ich übernahm dann ihre Funktion gemeinsam mit Fräulein Lily Neufeld. Mehr als zwei Personen hat die Gestapo für die Fürsorgeabteilung nicht erlaubt.
Zu dieser Zeit hat die Gemeinde Wien ca. 200 Vormundschaften über außereheliche jüdische Kinder niedergelegt. Die Kultusgemeinde hat mich für diese Kinder als Vormund nominiert. Ich musste damals zum Jugendgericht gehen und habe bei dieser Gelegenheit das erste Mal meinen zukünftigen Gatten kennen gelernt. Ich war so frappiert, denn wenn man in dieser Zeit in ein Amt gekommen ist, musste man als Erstes die jüdische Kennkarte vorweisen. Es hat einem keiner der Beamten Platz angeboten. Ich war so erstaunt, weil mir der Richter, Herr Dr. Wilhelm Danneberg, die Hand gereicht und gesagt hat, ich solle mich niedersetzen und ihm sagen, wie er mir für meine Schützlinge helfen könne, er werde es tun. Er hat es auch effektiv getan. Die ganzen Jahre stand er mir mit Rat und Tat zur Seite. Das war ungefähr im Dezember 1938. Kurz danach wurde er wegen seiner "Judenfreundlichkeit" vom Richterdienst suspendiert.
Die Gemeinde Wien hat auch alle jüdischen Pflegekinder, die sie in ihren Heimen hatte, der Kultusgemeinde übergeben. Wir standen plötzlich da, wir hatten wohl drei Heime, aber mussten noch so viele Kinder übernehmen, die in christlichen Anstalten untergebracht waren. Unsere Heime waren dadurch überfüllt. Wir haben ein Heim in der jetzigen Bauernfeldgasse, ein Heim in der Ruthgasse und eines in der Böcklinstraße gehabt. Da habe ich also meine 200 Kinder, für die ich die Vormundschaft übernommen hatte, unterbringen können. Das war für mich eine große Erleichterung, weil ich dadurch den ständigen Kontakt mit den Kindern hatte. Ich konnte den Heimen Bekleidung für die Kinder beschaffen, ich habe geschaut, dass die Kinder richtige Ernährung bekamen, dass genug Lebensmittel in den Heimen waren. Wir hatten zum Beispiel im 2. Bezirk in der Tempelgasse [die Tempelgasse wurde nach dem "Anschluss" nach einem illegalen Nationalsozialisten in Mohapelgasse umbenannt] noch ein Heim für Säuglinge. In dieser Zeit bekamen wir aber für die Säuglinge keine Vollmilch. Da gab es zwei Bäcker im 18. Bezirk, die mir jeden Tag zwei Zehn-Liter-Flaschen Vollmilch und 20 Kilo Brot zur Verfügung stellten. Ich musste um 5 Uhr in der Früh in den 18. Bezirk fahren und die Vollmilch sowie die 20 Brote vom 18. Bezirk in den 2. Bezirk tragen, damit unseren Kindern auch Vollmilch zur Verfügung stand.
Ich war außerdem noch Vormund von ca. 20 jüdischen geistig behinderten Jugendlichen. Diese Jugendlichen waren in einer Anstalt im 19. Bezirk, in einer nichtjüdischen Anstalt, und zwar bei Frau Direktor Ehrenberger, untergebracht. Die Eltern konnten die Kinder, weil sie geistig behindert waren, weder nach Amerika noch nach Palästina, noch in irgendein anderes Land bringen, da die Länder die Einreise dieser Kinder verweigerten. So waren diese 20 bis 25 Eltern gezwungen, ihre Kinder in die Anstalt zu geben. Es waren Jugendliche und schon Erwachsene, die geistig mit Kindern von sechs bis zehn Jahren zu vergleichen waren. Die Spesen der Heimunterbringung hat, soweit die Eltern nicht dafür sorgten, die Kultusgemeinde übernommen. Eines Tages rief mich Frau Direktor Ehrenberger an und teilte mir mit, es sei ein Anruf von der Heil- und Pflegeanstalt "Am Steinhof" gekommen, dass die Kinder in den nächsten Tagen abgeholt werden. Jetzt habe ich Schützlinge darunter gehabt, die geistig so waren, dass man sie eventuell in einer Privatwohnung unterbringen konnte. So bin ich in meiner Verzweiflung ins damalige Rothschild-Spital zu Herrn Prof. Dr. Viktor Frankl gegangen, habe ihm meine Situation geschildert, er hat mir sofort Plätze für die fünf Kinder gegeben, und ich konnte die fünf Kinder im Rothschild-Spital unterbringen, das heißt, Kinder waren es keine mehr, sondern Jugendliche.
Am nächsten Tag sind die anderen Kinder von Mitarbeitern des Psychiatrischen Krankenhauses geholt worden. Ich durfte mitfahren. Die Kinder haben gespürt, dass etwas Schreckliches mit ihnen passiert, sie haben sich krampfhaft an mich geklammert. So sind wir in desolatem Zustand in das Psychiatrische Krankenhaus gekommen. Ich bin damals zum Direktor gegangen, habe den Direktor gebeten, die Kinder doch "Am Steinhof" zu belassen. Er hat mir gesagt, ich müsse über jedes Kind einen Lebenslauf machen und ihm den am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh präsentieren. Am nächsten Tag hat man mich nicht mehr zu Herrn Direktor vorgelassen, sondern gesagt, dass diese Jugendlichen bereits abtransportiert worden sind. Diese Kinder wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit in Oberösterreich, Hartheim in der Gaskammer ermordet. Aus Gründen der Tarnung wurden Sterbeurkunden aus der Irrenanstalt Chelm an mich gesandt. Als Vormund habe ich die Todesanzeigen bekommen, dass die Kinder an Herzversagen verstorben sind. Diese Unterlagen habe ich alle aufgehoben, um sie einmal der Nachwelt zu präsentieren. Leider sind bei einem Bombenangriff alle Unterlagen in Verlust geraten. Wir haben im Jahre 1941 gewusst, dass "Am Steinhof" Kinder euthanasiert werden. Der Euthanasie fielen mehrere hundert Kinder aus der Heil- und Pflegeanstalt "Am Steinhof" zum Opfer. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber gewusst haben wir, dass diese behinderten Kinder und Jugendlichen, die an und für sich gesund waren, umgebracht worden waren. Als ich gesehen habe, dass ich eine Todesnachricht nach der anderen bekomme, haben wir gewusst, dass das nicht auf normale Art und Weise geschehen sein konnte.
Im Jahre 1942 sind die Kinder aus dem Heim Bauernfeldgasse und aus dem Heim Böcklinstraße mit dem Personal deportiert worden. Nach der "Evakuierung" dieser beiden Heime wurden alle noch vorhandenen Kinder im Heim Tempelgasse untergebracht. Dieses Heim wurde bis zum Jahre 1945 von der Kultusgemeinde erhalten. Uns ist also nur dieses eine Heim in der Tempelgasse geblieben. Diese Kinder und Jugendlichen konnte ich effektiv retten, da sie "Halbjuden" waren. Das heißt, es waren Kinder, die einen nichtjüdischen Elternteil hatten, aber der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörten.
Diesbezüglich ein kleines Beispiel. Es wurde eine jüdische Frau, Frau Munk, während ihres Aufenthaltes im Gefangenenhaus von Brünn schwanger. Das hat man nicht gewusst, sondern man hat gedacht, sie habe einen Tumor. Sie ist zur Untersuchung nach Prag geschickt worden. Von Prag ist sie nach Wien gekommen. In Wien hat sich herausgestellt, die Frau hat keinen Tumor, die Frau ist schwanger. Daraufhin hat man nachgerechnet und ist draufgekommen, dass die Frau während ihrer Gefangenschaft geschwängert worden sein muss. Man hat durch Mithäftlinge herausgefunden, wer der Vater dieses Kindes ist, und hat den Vater hingerichtet. Die Frau ist hier im Gefangenenhaus gewesen, wurde nur zur Entbindung ins Rothschildspital gebracht. Da habe ich sie das erste Mal persönlich kennen gelernt. Sie ist zehn Tage im Spital geblieben, aber schon ein paar Tage nach der Entbindung hat man mich zur Gestapo am Morzinplatz zitiert. Man hat mir mitgeteilt, ich solle der Mutter sagen, dass sie entweder nach Ravensbrück ohne das Kind oder mit dem Kind nach Theresienstadt deportiert wird. Die Frau solle mir ihre Entscheidung mitteilen. Dieser Weg ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe es getan, ich habe ihr gesagt, es gehe um ihr Kind, sie könne entweder das Kind, das war der kleine Denny Munk, in unserem Heim lassen und nach Ravensbrück ins Konzentrationslager gehen oder mit dem Kind nach Theresienstadt "evakuiert" werden. Sie hat sich sofort entschieden, hat gesagt: "Frau Löw, bitte lassen Sie Denny bei sich, nehmen Sie das Kind in Ihr Heim auf, ich gehe nach Ravensbrück." Sie ist zwei, drei Tage später nach Ravensbrück deportiert worden, hat mir aus Ravensbrück geschrieben. Ich habe ihr auch Pakete geschickt, so wie ich sie den anderen KZlern geschickt habe, und ihr regelmäßig geschrieben, wie es dem Kind geht und wie lieb das Kind ist. Denny hat hier in unserem Heim die Befreiung erlebt. Die Mutter ist in Ravensbrück von den Alliierten befreit worden. Sie hat sich sofort mit dem Roten Kreuz ins Einvernehmen gesetzt, hat mich suchen lassen, mich gefunden, angerufen und gesagt, sie sei in Schweden; sie hatte nur einen Wunsch, nämlich ihr Kind bald zu sehen. Daraufhin hat das Rote Kreuz Denny von hier geholt, und das Kind ist so zu seiner Mutter gekommen.
Die Jugendfürsorge hat nach dem "Anschluss" unter anderem auch Kindertransporte organisiert, die nach England, Frankreich, Holland, Belgien und in die Schweiz gegangen sind. Es war meine Aufgabe, mir die Kinder anzuschauen, mit den Kindern ein Gespräch zu führen und dem ganzen Ansuchen einen kleinen Bericht über das Kind und über seine Familie beizulegen. Die Leute in den verschiedenen Ländern haben sich dann nach diesem Bericht gerichtet und sich so die Kinder ausgesucht. Ich habe leider keinen Einfluss gehabt, ob das Kind nach Belgien oder nach Frankreich kommt, ich habe nur versucht, diese Kinder so nett wie möglich zu beschreiben. Zum Beispiel habe ich beim Testen ein vierjähriges Kind gefragt: "Wozu hast du die Zähne?", da hat es gesagt: "Zum Zähneputzen." - "Und wozu hast du die Ohren?" - "Zum Hören." - "Und wozu hast du die Mutti?" Da hat es dann große Augen gemacht, die Mutti angeschaut und gesagt: "Die Mutti habe ich zum Liebhaben." Das habe ich zum Beispiel in diesen Bogen geschrieben, dass das Kind so reagiert hat, und danach haben sich die Familien die Kinder ausgesucht. Aber Einfluss, ob das eine Kind drankommt oder das andere, diesen Einfluss hatten wir leider nicht. Wir trachteten nur, einen Kindertransport nach dem anderen aus Österreich herauszubringen. Es war natürlich für die Eltern auch sehr schwierig, sich von den Kindern zu trennen, aber die Kinder kamen ins Ausland und damit in Sicherheit.
Wir haben gehofft, dass wir viel mehr Jugendliche mit der "Alijah" nach Israel bringen könnten, doch nur ein kleiner Teil der Jugendlichen ist wirklich nach Israel gekommen.
Ich hatte einen ganz besonderen Schützling, der von der Kultusgemeinde bei einer Pflegemutter untergebracht worden war. Diese Pflegemutter wurde im Jahr 1941 "evakuiert". Den Jungen, Harry Gelbfarb, haben wir dann in unser Heim aufgenommen. Er hatte einen "arischen Vater"; diesen "arischen" Vater habe ich gut gekannt. Er hat stets Alimente für das Kind bezahlt. Als der Junge 14 Jahre alt geworden ist und bei uns in der Kultusgemeinde als Schlosserlehrling zu arbeiten angefangen hat, habe ich dem Vater gesagt, er soll keine Alimente mehr bezahlen, damit das dem Kind nicht einmal schadet. Eines Tages musste ich Harry in das Sammellager im 2. Bezirk, Malzgasse, zum gefürchteten Alois Brunner bringen. Ich habe Herrn Brunner gesagt, dass der Junge getauft und eigentlich "Mischling ersten Grades" sei. Das war um 11 Uhr nachts. Daraufhin hat Brunner gesagt, wenn ich den Beweis erbringe, dass der Junge noch vor dem Stichtag [15. September 1935] getauft worden ist, dann kann der Junge wieder freikommen. Da bin ich in meiner Verzweiflung - ich hatte gute Kontakte zur evangelischen und katholischen Fürsorge - in die Erzdiözese Wien in die Rotenturmstraße gegangen. An diesem Tage machte Pater Born Dienst. Dieser hatte mir schon in vielen Fällen geholfen, indem er mir zum Beispiel Medikamente für die Kranken zur Verfügung stellte.
Zu diesem Pater Born bin ich gegangen und habe ihm gesagt, es geht um Tod oder Leben, ich kann dieses Kind freibekommen, wenn ich mit einem Taufschein nachweise, dass das Kind bereits vor dem Jahre 1935 getauft worden ist. In seinem Zimmer hat Pater Born in einer Ecke ein Kruzifix gehabt. Er hat sich zu diesem Kruzifix hingekniet, hat lange gebetet, ist dann zu mir zum Schreibtisch gekommen, hat mir einen Taufschein auf den Namen des Kindes ausgestellt, hat den Taufschein unterschrieben und den Stempel draufgedrückt. Ich bin mit dem Taufschein um Mitternacht in das Lager zurückgegangen, habe dem Brunner den Taufschein gegeben; darauf sagte er, das Kind ist frei, ich kann mit dem Kind ins Heim. [...]
Ich bin am nächsten Tag bereits um sechs Uhr in der Früh in die Kultusgemeinde gegangen, weil ich gewusst habe, ich werde Schwierigkeiten bekommen. Kaum bin ich beim Haustor gewesen, ist der Portier auf mich zugekommen, hat gesagt: "Der Amtsdirektor, Herr Dr. Löwenherz, ist bereits im Haus, schreit wie ein Verrückter." Ich musste sofort zu ihm kommen. Ich bin zu seiner Sekretärin gegangen, die hat mir gesagt: "Franzi, was haben Sie heute Nacht angestellt." Ich sagte: "Ich werde Herrn Direktor Löwenherz alles klipp und klar erzählen, was ich gemacht und wie ich es gemacht habe." Zuerst hat Herr Direktor Löwenherz geschrien, und dann habe ich gesagt: "Herr Amtsdirektor, jetzt lassen Sie mich zuerst bitte erklären, was ich gemacht habe." Daraufhin war der Amtsdirektor nach dem Bericht ganz still, hat nur eingewendet: "Was werden wir jetzt machen, wenn die Gestapo uns Schwierigkeiten bereitet?" Die Gestapo hat aber keine Schwierigkeiten gemacht, hat sich nicht gerührt. Das Kind ist im Heim geblieben, hat den Umsturz hier in Wien überlebt. [...]
Von den 70 Kindern, die wir im Jahre 1942 im Heim Tempelgasse hatten, wurden noch ca. 40 deportiert, sodass ca. 30 Kinder in der Tempelgasse verblieben. Einige Transporte der Heimkinder sind direkt in die Gaskammern gegangen. Die Kinder, die einen nichtjüdischen Elternteil hatten, konnten hier bleiben. Von manchen dieser Kindern haben wir gewusst, dass sie einen nichtjüdischen Elternteil haben, da habe ich den Auftrag bekommen, für diesen nichtjüdischen Teil einen "Ariernachweis" zu beschaffen. Bei anderen Kindern, bei denen im Geburtsschein nicht gestanden ist, wer der Vater war, habe ich es so gemacht, dass ich dem Vormundschaftsgericht geschrieben habe, dass der Vater des Kindes so und so heißt. Ich habe irgendeinen Namen genommen und habe in einem Taufbuch nachgeschaut, wann und wo der Betreffende geboren worden ist. Dann konnte ich mir einen Taufschein des Vaters besorgen, der nicht der wirkliche Vater war, und durch diesen Taufschein konnte ich die anderen Dokumente der Eltern beschaffen und so beweisen, dass die Kinder einen nichtjüdischen Elternteil hatten. Dadurch habe ich diese Kinder retten können.
Ein weiterer wichtiger Punkt meiner Tätigkeit war die Gefangenenfürsorge. Speziell nach dem 10. November 1938 [Novemberpogrom] gab es viel zu tun, da viele Leute verhaftet worden sind und man trachten musste, den Menschen die lebensnotwendigsten Sachen in die Gefangenenhäuser zu bringen. Ich durfte das als Fürsorgerin nur denjenigen bringen, die keine Angehörigen hatten. So habe ich täglich, mit einem schweren Rucksack bepackt, Sachen in die Gefangenenhäuser getragen. [...]
Außerdem sind unsere Wiener Juden in verschiedene Konzentrationslager verschickt worden, und auch dorthin durfte ich einmal im Monat Pakete schicken. Aber nur unter meinem Namen, nicht unter dem Namen der Israelitischen Kultusgemeinde. Wir schickten Zucker, Marmelade, Brot, aber auch Kartoffeln und Leibwäsche. Die Empfänger konnten vom KZ aus diese Pakete bestätigen und schrieben mir dann dazu, was sie sich noch wünschten. Diese Sachen haben sie dann auch wirklich bekommen. Diesen Teil der Fürsorge für die KZler hat ausschließlich meine Mitarbeiterin Fräulein Lily Neufeld bearbeitet, weil ich nicht imstande gewesen wäre, auch noch diese Arbeit zu bewältigen. Ich habe gewusst, wie es in einem KZ zugeht. Ich bin einmal in Mauthausen gewesen. Ich habe leider nur ein einziges Mal die Bewilligung von der Gestapo bekommen, dieses KZ zu besuchen. Warum, kann ich heute nicht mehr sagen. In Mauthausen habe ich gesehen, was ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Ich habe einen derartigen Schock bekommen, als ich dieses KZ verlassen hatte, dass ich niemandem gegenüber - auch heute nicht - darüber spreche, was ich dort erlebt habe. [...]
Guten Kontakt hatte ich zu den folgenden Hilfsorganisationen. In der Rotenturmstraße, im Erzbischöflichen Palais, war die "Hilfsstelle für nichtarische Katholiken". Die Leitung dieser Organisation hatte Pater Born inne. Ihm zur Seite stand die unvergessene Schwester Verena von der Caritas Socialis, die sich für ihre Schützlinge aufopferte, sowie Frau Perner, die für die Katholiken und für die Andersgläubigen immer mit viel Geduld und Liebe ihre Arbeit verrichtete. Diese katholische Hilfsstelle hat mich die ganzen Jahre mit Medikamenten, Lebensmittelmarken und Geld unterstützt, ganz egal, ob ich die Sachen für evangelische, konfessionslose oder mosaische Juden gebraucht habe. Pater Born hat diesbezüglich keinen Unterschied gemacht. Im Jahre 1942 hat man es Pater Born nicht mehr gestattet, sich um katholische Juden zu kümmern. Es ist dann, wie ich schon einmal erwähnte, der "Ältestenrat der Juden in Wien" für sie zuständig gewesen. Trotzdem stand aber Pater Born mir persönlich immer weiter mit Rat und Tat, mit Geld, Lebensmittelkarten und Medikamenten zur Verfügung.
Eine evangelische Hilfsorganisation existierte auch in Wien, und zwar unter anderem in der Person von Frau Mala Granat aus Schweden. Auch Frau Granat hat mich mit Lebensmittelkarten und Geld reichlichst unterstützt.
Lebensnotwendige Gegenstände erhielt ich auch von der "arischen" Bevölkerung Wiens. Gleich im Jahre 1939 habe ich begonnen, Lebensmittel zu sammeln. Es war die nichtjüdische, christliche Wiener Bevölkerung, die mir damals bereits geholfen hat. Ich war fast jeden Abend in irgendeiner anderen christlichen Familie, die in ihrer Umgebung für mich "arische" Lebensmittelmarken und Bekleidung gesammelt hat. So war ich einmal wöchentlich bei der Tochter von Primarius Dr. Riese, um Sachen zu holen. Einmal in der Woche, und zwar immer an einem Donnerstag, war ich im Hause Danneberg. Die Freunde der Dannebergs haben am Tiefen Graben Lebensmittelmarken, Geld, Naschereien für die Kinder gesammelt, um mir dann all dies zu übergeben. Der Hausbesorgerin, der ich aufgefallen bin, habe ich immer ein reichliches Trinkgeld in die Hand gedrückt. Daher meinte sie immer: "Ja, heute ist Donnerstag, da kommt die Blade [Dicke] mit dem großen Rucksack." Gott sei Dank hat sie mich niemals angezeigt. [...]
Trotzdem auch ich ständig Angst vor der "Evakuierung" hatte, habe ich immer versucht, meinen Mitmenschen zu helfen. Ich bin hinter meinen Schützlingen gestanden und habe versucht, der SA und SS zu zeigen, dass ich trotz der vielen Plagen, die man uns auferlegt hat, immer versucht habe, jedem Bedürftigen eine Hilfe zu sein. Ich bemühte mich, den Nazis zu zeigen, dass ich keine Angst vor ihnen hatte, und ich glaube, das hat ihnen in irgendeiner Form imponiert. Daher ließen sie mich arbeiten, auch wenn ich einsehen musste, dass meine Arbeit immer nur einen kleinen Erfolg zeitigte.




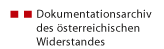







 English
English Termine
Termine Neues
Neues