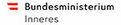Dagmar Ostermann geb. Bock, geb. 1920 in Wien, ab April 1938 Dresden. Im August 1942 als "Mischling 1. Grades" verhaftet und über das KZ Ravensbrück nach Auschwitz-Birkenau deportiert, durch Zufall Position einer Schreiberin am Standesamt der Politischen Abteilung im Stammlager Auschwitz, von dort Anfang November 1944 wieder nach Ravensbrück und im Dezember 1944 in das KZ Malchow (Außenkommando von Ravensbrück) überstellt. Dort erlebte sie die Befreiung 1945.
Rückkehr nach Wien. Generalsekretärin der Österreichischen Lagergemeinschaft Auschwitz. 2005 Veröffentlichung ihrer Lebenserinnerungen "Eine Lebensreise durch Konzentrationslager" (hrsg. von Martin Krist).
Verstorben 2010.
Dagmar Ostermann, die das Kriegsende im KZ Malchow erlebte, kehrte Ende Mai 1945 nach Wien zurück.
Jetzt war ich endlich auf der anderen Seite der Donau, also ich war im 2. Bezirk. Und ich war in Wien. Da bin ich dann zu meinem ehemaligen Wohnhaus weiter. Ich komm' dorthin, und das war eine ausgebrannte Ruine. Da hing noch am letzten Zipfel ein Zettel: "Frau Ruth Rosenfeld [Mutter von Dagmar Ostermann] zu finden: Mollardgasse 35, Baptistengemeinde." Wenn ich eine Minute später komme, hat der Wind das vielleicht weggerissen. Da habe ich das erste Mal richtig geweint, seitdem ich verhaftet worden bin. Das war, wie wenn in mir etwas bricht, wie ein Damm, der bricht. Ich lehne dort so an der Hauswand und weine, und auf einmal klopft mir jemand auf die Schulter und sagt: "Entschuldigen Sie bitte, was haben Sie da für eine Nummer auf dem Arm?" Ich denke: "Mein Gott, ich tu' ihr wahrscheinlich leid", aber ich habe gesagt: "Das ist eine KZ-Nummer." - "Gehn S', bitte schön, haben Sie vielleicht Bleistift und ein Papier? Ich möchte mir Ihre Nummer aufschreiben, weil wenn die Lotterie beginnt, möchte ich gerne die Nummer in der Lotterie setzen." Das war meine erste Begegnung in Wien. Die hat nicht gesagt: "Warum sind Sie ins KZ gekommen? Wieso sind Sie ins KZ gekommen?" Die wollte sich die Nummer aufschreiben, damit sie sie in der Lotterie spielen kann. Bleistift und Papier hatte ich nicht, aber sie konnte sich die Nummer aufschreiben. Was weiß ich, womit sie die irgendwo draufgeschrieben hat. Das war mein erster Kontakt mit einem Wiener. [...]
Jetzt war ich aber schon ehrlich müde, es war schon wieder späterer Nachmittag. Ich bin in den sechsten Bezirk hinübergegangen, habe mich durchgefragt und endlich das Haus der Baptistengemeinde gefunden und geläutet. Oben haben sich die Fenster geöffnet, einige Frauen haben herausgeschaut. Eine hochgewachsene Frau mit Brille hat gesagt: "Du kannst nur die Dagmar sein!" Die haben mich irgendwie sofort erkannt, obwohl sie mich nie vorher gesehen hatten. Später habe ich erfahren, dass meine Mama nach meiner Verhaftung wieder in die Baptistengemeinde gegangen ist, weil sie wieder zu ihrer Religion zurückgefunden und natürlich Trost gesucht hat. Sie hat natürlich auch Fotos von mir dort hergezeigt gehabt. Ich habe sofort gefragt: "Wo ist die Mama? Wo ist die Mama?" "Sie ist nicht da, aber wir holen sie gleich, sie wohnt jetzt im dritten Bezirk, in der Wohnung einer Bekannten." Wirklich haben sie meine Mutter geholt. Sie hat ausgeschaut, als ob sie im Konzentrationslager gewesen wäre. Ich habe zu der Zeit nämlich schon wieder recht gut ausgeschaut. Ich habe ja schon zu essen gehabt, weil man uns unterwegs nach Tunlichkeit und Möglichkeit sehr gut gefüttert hat. Jeder hat wollen das Seine dazutun, seine Schuld vielleicht damit irgendwie abtragen. [...] Meine Mutter hat zuerst überhaupt nicht reden können, sie war fassungslos. Sie hat auch gesagt, wenn ich ein paar Tage später gekommen wäre, sie hätte es nicht überlebt. "Ich hätte mir nicht das Leben genommen", meinte sie. Aber sie hat gehungert, sie hat nichts runtergebracht; was sie gegessen hat, hat sie gebrochen. Die Nerven haben ihr natürlich sehr mitgespielt, weil sie Angst gehabt hat. Für sie war der 12. April ja Kriegsende gewesen, und nun war schon der 30. Mai. [...]
Ich habe mir gedacht: "Das Erste, was wir brauchen, ist eine Wohnung, alles andere ist unwichtig." Jetzt habe ich erst einmal eine zuständige Stelle gesucht; das Wohnungsamt für den sechsten Bezirk war in der Amerlingstraße, wo jetzt das Amerlinggymnasium ist. In der Kopernikusgasse war die Polizei, dort habe ich dann meine Ansprüche angemeldet. Ja, ich muss warten, hat es geheißen. Ich habe gesagt: "Ich werde nicht warten. Ich komme vom Konzentrationslager und mein Haus ist kaputt." Da haben sie mich zuerst einmal auf eine andere Stelle geschickt. Da habe ich dann Essensmarken bekommen für den "Salzburgerhof" in der Otto Bauergasse. Beim Raimundtheater ist ein Bäcker - der existiert heute noch -, dort haben wir Brot für Marken bekommen, und im "Salzburgerhof" - das ist am Eck, wo jetzt das Haus der Begegnung ist - konnte man mittagessen und abendessen. Es war natürlich eine einfache Küche. Dann haben wir eine Zeitlang auch im "Münchnerhof" Essen bekommen. Aber mit der Wohnung wollte es nicht klappen. Da habe ich auf den Tisch gehaut und habe gesagt: "Also, wenn ich keine Wohnung bekomme, wer dann?" Man hat mich beim einen Türl hinausgeschmissen, ich bin beim anderen hinein. Und dann habe ich gesagt, nachdem sie mich zwei Tage vertröstet hatten: "So, jetzt bleibe ich hier sitzen. Und wenn ich die ganze Nacht hier sitzen muss, wenn ich keine Wohnung bekomme." Ich bin natürlich gleich aggressiv geworden: "Den Nazis gebt ihr's und mir nicht." Vorher habe ich mich registrieren lassen im Rathaus, wo man sich als KZ-ler registrieren lassen musste. Da hat man sozusagen einen Ausweis bekommen, dass man bevorzugter behandelt werden konnte und musste. Da habe ich gesagt: "Was nützt mir der ganze Wisch, wenn ich da keine Wohnung kriege. Ich muss eine Wohnung kriegen." Dann haben die Beamten gesehen, ich bin nicht abzuwimmeln. Ich bin dann hart geworden, und so habe ich eine Wohnungszuweisung bekommen. Da hat es aber geheißen, in dieser Wohnung wohnt noch eine Deutsche mit ihrem Kind. Ich habe gesagt: "Ich will keine Wohnung haben, wo jemand drinnen wohnt, ich will eine Wohnung alleine für mich." - "Ja, es ist sowieso ein Gesetz, die Deutschen müssen weg."
Ich habe mir aber gesagt, bevor ich diese Wohnung nehme, gehe ich mich erst einmal erkundigen, und bin von der Amerlingstraße in die Kopernikusgasse zur Polizei gegangen. Der Bezirksleiter von der Polizei war ein gewisser Robert Calta, ein sehr anständiger, netter Kerl, der mich sehr nett empfangen hat. Wie er gehört hat, dass ich KZ-lerin bin, war er überhaupt ganz angetan. Er hat mir erzählt, seine Schwägerin ist auch im KZ gewesen, er weiß noch gar nicht, ob sie schon da ist. Der war ein alteingesessener Sozialdemokrat, kein Überläufer, wie auch viele bei der Polizei waren. Er hat gesagt: "Ja, wir werden das gleich haben," und hat seinen Stellvertreter gerufen. Der hat gemeint: "Hören Sie zu, Fräulein Bock, selbstverständlich können Sie in diese Wohnung einziehen, denn wir haben hier schon die ganzen Listen. Diese Leute werden per Schub nach Deutschland zurückgebracht. Das sind Deutsche, die in Ihrer Wohnung wohnen." Darauf sage ich: "Reichsdeutsche? Ich will niemanden aus der Wohnung vertreiben. Es gibt bestimmt leere Wohnungen genug. Aber wenn die wegmüssen, dann müssen die ja sowieso weg. Aber ich bin nicht bereit, in eine Wohnung mit jemandem zu ziehen, ich will nicht mehr mit jemandem zusammen sein. Ich habe von Gemeinschaft im Augenblick genug; noch dazu mit fremden Menschen." - "Nein, nein, schauen Sie sich die Wohnung an, und wenn sie schön ist, nehmen Sie sie." Ich bin dorthin gegangen. Das war eine gewisse Frau Böhm, die mir sehr sympathisch war, mit einem fünfjährigen Mäderl. Sie sagt: "Sie sind mir eingewiesen in die Wohnung?" Und ich sage: "Ja, sehr gegen meinen Willen, aber sonst kriege ich keine andere." - "Ja", sagt sie, "wir müssen ja sowieso weg." "Aber ich soll nicht dran schuld sein", habe ich gesagt, "ich weiß, wie das ist, wenn man vertrieben wird. Ich soll nicht dran schuld sein, obwohl ich ja weiß, dass Sie in einer Wohnung wohnen, wo früher Juden gewohnt haben." - "Ja, aber dafür können wir ja nichts. Mein Mann ist ja vom Militär aus hergekommen. Uns hat man diese Wohnung gegeben." - "Schauen Sie, Frau Böhm, ich bin kein Richter. Mich hat man in diese Wohnung eingewiesen, ich will nicht diejenige sein, die Sie vertreibt. Aber wenn Sie weg müssen, müssen Sie weg." [...]
Das hat sich jetzt gezogen. Ich habe mit meiner Mutter in Zimmer-Kabinett gewohnt, das andere Zimmer hat die Frau Böhm bewohnt. Dann bin ich noch einmal auf die Polizei gegangen und habe gesagt: "Hören Sie zu, mir ist das sehr unangenehm, ich fühl' mich dort wie ein Eindringling. Die schaut mich immer so vorwurfsvoll an, wie wenn ich was dafür könnte, dass sie raus muss. Jetzt will ich wissen: müssen die weg oder nicht? Sonst will ich eine andere Wohnung haben, ich will in der Wohnung nicht bleiben. Ich werde dort in dem Haus angeschaut, wie wenn ich die Leute vertreiben möchte. Ich will das nicht." "Nein", sagt der, "übermorgen müssen sie weg. Sie muss übrigens den Bescheid schon haben, dass sie sich sammeln muss." Sie durfte nur das mitnehmen, was sie tragen konnte. Vom Magistrat kam ein Beamter, der eine Aufstellung über das Inventar machte und dessen Wert schätzte. Nach einigen Jahren habe ich es über die Deutsche Botschaft abgelöst. Am nächsten Tag hat sie sich verabschiedet. Am Abend habe ich noch irgendwo ein Flascherl Wein organisiert und ein bisserl was zu essen. Da haben wir so eine kleine Abschiedsfeier gemacht. Natürlich, am meisten hat sie sich selbst leid getan, aber verständlich. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir war es auch nicht egal. Mir war das so nicht recht, dass man mir so eine Wohnung gegeben hat. Obwohl ich nichts dafür konnte, hat man doch irgendwie das Gefühl, man ist mitschuldig. [...]
Dann bin ich zur "Volkssolidarität" gegangen. Die hat sich als Organisation gebildet, die sich der KZ-ler angenommen hat, von KZ-lern geschaffen. [...] Ich hab' dann dort in dieser "Volkssolidarität" gearbeitet, und zwar hab' ich die Jugendfürsorge übernommen. Das heißt, Jugendliche, deren Eltern in KZs waren oder in KZs umgekommen sind, betreut und denen ein bisschen zur Seite gestanden. Später kamen dann auch Kriegswitwen und andere Bedürftige zu uns. Wir haben auch Aufklärungsarbeit gemacht. Vor allem haben wir sehr stark gearbeitet mit Bildern, wir haben praktisch eine Ausstellung gemacht. Wir haben versucht, Bilder zu bekommen und Niederschriften usw. Die wurden in Auslagen gelegt, fast in Form einer Ausstellung, um einmal die Bürger aufmerksam zu machen. Das war eine erste Information über das Leben im KZ. [...] Dort habe ich dann auch meinen zukünftigen Mann kennengelernt.




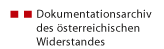








 English
English Termine
Termine Neues
Neues