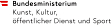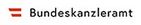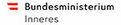von Andreas Kranebitter, 26. September 2025
Gedenkveranstaltung, Gemeindezentrum Gramatneusiedl
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Opferverbände, sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich persönlich doppelt, heute hier bei ihnen sein zu dürfen. Zum einen verbindet mich über mein Fach, die Soziologie, und die berühmte Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel eine lange Geschichte mit Gramatneusiedl und Marienthal, zum anderen freut es mich, dass es heute zu dieser so wichtigen Gedenkveranstaltung zu Ehren des Widerstandes und der Widerständigen gegen den Nationalsozialismus kommt, zu der das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes natürlich gerne beigetragen hat und beiträgt. Ich möchte zuallererst Gramatneusiedl und Dir, lieber Herr Bürgermeister, gratulieren und Euch dafür danken, dem Widerstand ein Denkmal zu setzen. Eure Geschichte ist zweifach untypisch für Österreich: Sowohl das früh aufgestellte Denkmal für die fünf Widerstandskämpfer des Ortes, das so zentral am Gemeindefriedhof sichtbar ist, als auch die heutige Aktion sind einzigartig, aber hoffentlich beispielgebend.
Ich möchte die fünf Widerstandskämpfer in Gramatneusiedl ins Zentrum rücken, an die fünf individuellen Biografien erinnern, in denen sich die große Geschichte spiegelt.
Ab Sommer 1943 hob die Gestapo in Groß-Wien oder im früheren Umfeld von Wien mehrere kommunistische Widerstandsgruppen aus, die lose miteinander in Verbindung gestanden waren. Auch fünf Personen aus Gramatneusiedl, das in der NS-Zeit zu Wien gehörte, wurden verhaftet. Es waren der Maschinenarbeiter Leopold Hadáček, die Bauarbeiter Johann und Josef Kníže, der Bauhilfsarbeiter Felix Kolář und der Drehergehilfe Albert Seifert.
Sie alle wurden in drei verschiedenen Gerichtsverfahren vom 5. Senat des Volksgerichtshofes beim Landgericht Wien wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ und „Feindbegünstigung“, wie es in der NS-Diktion hieß, zum Tode verurteilt und 1944 im Landesgericht Wien hingerichtet.
***
Was wissen wir von ihnen, wer waren sie? Leopold Hadáček wurde am 29. Oktober 1914 in Wien geboren – er war zum Zeitpunkt seines Todes also gerade einmal 30 Jahre alt – und lebte in Mitterndorf. Hadáček wurde als uneheliches Kind geboren und von den NS-Behörden als „Protektoratsangehöriger“ geführt, also als Angehöriger des „Protektorats Böhmen und Mähren“, wie die nationalsozialistische Zwangsverwaltung nach dem deutschen Einmarsch in der Tschechoslowakei hieß. Hadáček war Hilfsarbeiter in einer Spinnerei, aber auch in der Landwirtschaft tätig und als Maschinenarbeiter in Wien beschäftigt gewesen, hatte zwei Kinder mit seiner Partnerin und gehörte bis 1934 den Kinderfreunden und der SPÖ an.
Der Bauhilfsarbeiter Josef Kníže wurde am 22. Februar 1908 in Marienthal geboren und, wie die Gestapo in einem Tagesrapport schrieb, am 16. Juli 1943 in einer „Aktion gegen die KPÖ in Mitterndorf“ festgenommen. Seinen vier Jahre älterer Bruder Johann, ebenfalls Bauarbeiter, nahm die Polizei zwei Wochen später fest. Johann hatte auch als Kesselputzer, Dachdeckerhilfsarbeiter oder Spulenzieher gearbeitet, war Mitglied des Republikanischen Schutzbundes, der freien Gewerkschaft der Textilarbeiter und Kassier der Revolutionären Sozialisten gewesen. Josef hatte als Hilfsarbeiter gearbeitet, bis er ab 1931 für mehrere Jahre erwerblos wurde. Er war ebenso Mitglied der SPÖ gewesen wie der Bauhilfsarbeiter Felix Kolář, der älteste der fünf, der am 27. Dezember 1887 geboren wurden. Kolář hatte den Ersten Weltkrieg an der italienischen Front erlebt und wurde nach 1929 erwerbslos und war von da an als Kassierer Aktivist der SPÖ und der bereits im Austrofaschismus illegalisierten Revolutionären Sozialisten, wobei er ab Oktober 1938 im Verdacht kommunistischer Gesinnung stand.
Der Jüngste der fünf war der Drehergehilfe Albert (manchmal auch Adalbert) Seifert. Er wurde am 8. Mai 1921 in Ebergassing geboren, war bei seiner Verhaftung also 22 Jahre alt, und wohnte ebenfalls in Gramatneusiedl.
Was erzählen uns ihre Geschichten? Es sind Geschichten, die für Marienthal typisch sind: Geschichten von Hilfsarbeitern in den Fabriken der Umgebung, allen voran der Textilfabrik im Ort. Ihre Erwerbsbiografie wurden 1929 mit der Arbeitslosigkeit in Folge der Weltwirtschaftskrise plötzlich gebrochen. Wie die meisten anderen Arbeiter*innen in Marienthal waren sie sozialdemokratisch gesinnt gewesen, bis sie sich vor allem nach dem „Anschluss“ dem kommunistischen Widerstand anschlossen, weil sie etwas tun wollten. Sie waren also gar nicht so resignativ, wie man das nach der Marienthal-Studie vermuten würde, sondern äußert aktiv in der Arbeiter*innenbewegung im Ort tätig.
Ein vielleicht verborgenes Detail ihrer Geschichte besteht in der Tatsache, dass vier der fünf – die beiden Kníže-Brüder, Kolář und Hadáček – aus der tschechischen Minderheit stammten. Sie ist untrennbar mit der Industrialisierung und der Industrie des Ortes verbunden, aber so etwas wie eine unsichtbare Größe in Marienthal, auch in der berühmten Studie. Denn als die Sozialwissenschafter*innen in Marienthal aus dem Zug stiegen, waren ein Viertel der Arbeitslosen bereits abgewandert, viele davon Angehörige der tschechischen Minderheit. Einige blieben in Marienthal und sollten Austrofaschismus und Nationalsozialismus erleben – auch im aktiven Widerstand.
***
Was waren ihre Widerstandshandlungen? Was wurde ihnen vorgehalten? Hadáček und Seifert konnte man nachweisen, dass sie zwischen 1940 und 1942 die örtliche Gruppe des Kommunistischen Jugendverbandes in Mitterndorf leiteten, den beiden Kníže-Brüdern das gleiche für Gramatneusiedl, dessen KPÖ-Organisation sie bald der Wiener Leitung anschlossen. Die Tätigkeit beschränkte sich im Wesentlichen auf die sogenannte „Rote Hilfe“, d.h. das Einkassieren von kleineren Beiträgen von einzelnen Mitgliedern, um Verhaftete oder Hinterbliebene materiell zu unterstützen. In Marienthal unterstützte man etwa die Ehefrau eines in Spanien verschollenen „Spanienkämpfers“. Manchmal wurden die Beiträge auch der Wiener KJV-Leitung weitergeleitet, Kontakte bestanden auch zur Betriebszelle in den „Flugmotorenwerken Ostmark“ in Wiener Neudorf. Außerdem fand die Polizei bei ihren Hausdurchsuchungen kommunistische Literatur, allen voran die Flugschriften „Die rote Fahne“, und ein Gewehr mit 80 Schuss Patronen und zwei Handgranaten. Die Gruppe hatte sich einige Male in einer Schrebergartenhütte in Maria-Lanzendorf getroffen und dort Schulungsvorträge über Themen wie „Sabotagehandlungen“ oder die „soziale Frage“ organisiert. „Bei diesen Treffen“, so der Oberstaatsanwalt in seiner Anklageschrift, „wurden kommunistische Flugschriften verteilt, Beiträge gesammelt und allgemein kommunistische Unterhaltung gepflogen.“
Hadáček war der erste, gegen den Anklage erhoben wurde. Er habe sich nach einigem Zögern zur Leitung der KJV-Gruppe bereit erklärt, ein Mitglied geworben, Beiträge einkassiert und insgesamt viermal im Schrebergarten an Treffen teilgenommen. Sehr viel mehr an Aktivität konnte man ihm offenbar nicht nachweisen, denn die Flugschriften, die er zwei bis dreimal erhalten hatte, musste er vernichten, weil er sie nicht weitergeben konnte – wie auch Felix Kolář musste er die Erfahrung machen, dass „seine Zellenmitglieder die Annahme verweigerten“, wie der Staatsanwalt schrieb, wohl aus Vorsicht und Angst. Mit fünf anderen verurteilte ihn der 5. Senat des Volksgerichtshofs beim Landgericht Wien zum Tode. Einige seiner Mitangeklagten waren zum Zeitpunkt ihrer Taten teilweise jünger als 18 Jahre alt, konnten aber nach nationalsozialistischem Unrecht als Erwachsene verurteilt werden, wenn sie der Richter „in ihrer sittlichen und geistigen Reife“ für reif genug dafür hielt – und die Richter machten häufig Gebrauch von dieser Ermächtigung. Auch Albert Seifert wurde mit anderen zum Tode verurteilt, in einem dritten Verfahren erhielten auch die Brüder Kníže und Felix Kolář zusammen dasselbe Urteil.
***
Wie verteidigten sich die Angeklagten vor Gericht, was wussten sie über ihr Schicksal? Davon wissen wir nur sehr wenig, denn die Volksgerichtshof-Urteile sind äußert kurz. Mit den Angeklagten wurde im wahrsten Wortsinn kurzer Prozess gemacht.
Nur in knappster Form finden sich Hinweise auf ihre Sicht der Dinge, ihre Verteidigungsversuche und Gegenreden. Johann Kníže habe alles zugegeben, außer die Verbreitung von Flugschriften. „Er will sich weniger aus politischem Interesse als vielmehr zwecks Vermeidung des Anscheins persönlicher Feigheit für die KPÖ betätigt haben.“ Josef Kníže sei ebenfalls geständig gewesen, habe sich aber vehement verteidigt. Er wolle „eine soziale Besserstellung der Arbeiter unter einem kommunistischen Regime“. Kolář wiederum meinte, nur aus karitativen Motiven gehandelt zu haben. Was auch immer die Angeklagten vorbrachten, es interessierte das Gericht nicht – denn das Urteil stand von Anfang an fest.
Nur von Albert Seifert wissen wir mehr, denn er hat in der Haft einen letzten Brief an seine Mutter geschickt, die wiederum selbst verhaftet und vor dem Sondergericht wegen angeblicher „Heimtücke“ angeklagt worden war, weil sie „den Führer geschmäht habe“. In diesem Brief vom 8. Mai 1944, zwei Tage vor seiner Hinrichtung verfasst, schreibt der gerade 23 Jahre alt gewordene Seifert vier Seiten voll. Ich möchte ausführlich daraus vorlesen:
 „Liebe Mama!
„Liebe Mama!
Heute an meinen Geburtstag denke ich an Deinen. Und selten werden die Wünsche zweier Menschen so genau dieselben gewesen sein, als vielleicht gerade heute es die Deinen und meinen sind. […]
Oft erinnere ich mich an die Zeit wo ich noch bei ‚Albrecht‘ war. An die kurze Mittagspause. Wo das Essen schon am Tische stand wenn ich kam und die Zeitung lag daneben. Und wo wir immer noch die Zeit fanden, über dieses und jenes zu plaudern. Denkst Du daran? Mit solchen Gedanken und Erinnerungen banne ich meinen Geist, damit ich mich nicht in Grauen und Angst verzehre. Was ja hier nichts aussergewöhnliches wäre. Und es ist mir auch vollkommen gelungen. Alle meine Kameraden mit denen ich bis jetzt beisammen war, wurden in meiner Nähe ruhig und getröstet. […]
Vom sterben fürchte ich mich schon längst nicht mehr. Und meine Eigenschaft, im Traume zu lachen, habe ich auch hier nicht verloren. […] Und alle die uns könnten lachen hören, würden nie glauben daß wir für den Tod bestimmt sind. […] Nun bin ich fast fertig mit dem schreiben und habe noch immer nicht getan was ich am Anfang wollte und was ja eigentlich der Grund war, weswegen ich um diesen Sonderbrief bat. Nähmlich Dir liebe Mama alles Gute zu wünschen für Deinen kommenden Geburtstag und Dir sagen, wie oft ich an Dich denke.
Bleibe gesund und schenke ein klein wenig Deiner Liebe die Du mir nicht geben kannst den Meinen. […]
Dein Bertl.“
Wir können diese Worte lesen und hören, weil Alberts Mutter Johanna Seifert diesen Brief und ein Foto von ihm in den 1960er-Jahren dem DÖW übergeben hat. Es war der einzige Ort ist Österreich, der sich für Alberts Geschichte interessiert hat. Oft waren diese letzten Briefe aber auch im Akt liegen geblieben, wurden also nicht abgesandt und erreichten ihre Empfänger nie.
***
Wie ging die NS-Justiz mit den Angeklagten um? Die Antwort ist klar: Ohne jede Gnade. Alle Angeklagten wurden schuldig gesprochen, „durch Vorbereitung des kommunistischen Hochverrats die Feinde des Reiches begünstigt zu haben“, und zum Tode verurteilt. Das Gericht – unter Vorsitz von Volksgerichtsrat Johannes Heinrich Wilhelm Merten, dem nach 1945 wie allen anderen auf Seiten der Justiz Beteiligten in puncto Entnazifizierung nichts passieren sollte – machte es sich einfach: „Da schwere Folgen ihrer Taten nicht auszuschließen waren“, hieß es etwa wörtlich im Urteil gegen Seifert, in ähnlichen Worten aber in allen drei Urteilen der fünf Widerstandskämpfer, „mußten sämtliche Angeklagten zu der vom Gesetze […] angedrohten Todesstrafe verurteilt werden, ohne daß ihren Geständnissen und ihrer zum Teil bescheinigten guten Führung bei der Wehrmacht ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden konnte. Die Angeklagten haben sich durch ihre Tat innerlich aus der deutschen Volks- und Schicksalsgemeinschaft ausgeschlossen und verdienen daher nicht, Ehrenämter zu bekleiden. Die bürgerlichen Ehrenrechte waren ihnen deshalb auf Lebensdauer abzuerkennen.“
Der Reichsminister der Justiz ließ nach dem Urteil gegen Leopold Hadáček die Bitte vortragen, „mit größter Beschleunigung das Weitere zu veranlassen.“ Man regelte, dass Scharfrichter Johann Reichhart, der auch zahllose andere Widerstandskämpfer hingerichtet hatte, die Hinrichtung vorzunehmen habe, und dass die Leichname dem Anatomischen Institut in Wien zu übergeben seien.
***
Im Jahr 2024 hat das DÖW auf Initiative des Justizministeriums und insbesondere des Landesgerichtspräsidenten Fritz Forsthuber im Landesgericht Wien vor dem ehemaligen Hinrichtungsraum eine Ausstellung eröffnet. Wir haben diese Ausstellung „Man kann sie direkt sterben hören …“ genannt. Die Aussage stammt vom Widerstandskämpfer Alfred Svobodnik, der während des Wartens auf seine Hinrichtung im November 1942 dem evangelischen Seelsorger Hans Rieger das Fallbeil beschrieben hat, das in Abständen von weniger als einer Minute Mord nach Mord vollzog und im ganzen Gebäude zu hören war: „Man kann sie direkt sterben hören …“
Wie Leopold Hadáček am 7. Februar 1944, Albert Seifert am 10. Mai 1944, und Felix Kolář, Johann und Josef Kníže am 21. Juni 1944, wurden 1.186 Personen im damaligen Landgericht Wien hingerichtet. 640 von ihnen können dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zugerechnet werden: dem organisierten und individuellen Widerstand; dem kommunistischen, katholischen, monarchistischen, sozialdemokratischen Widerstand; dem Widerstand in den Betrieben wie in der Wehrmacht; der Opposition und dem allein, zu zweit, zu Hause oder auf offener Straße geäußerten Unmut über die NS-Herrschaft.
Die Hinrichtungen dauerten meist wenige Sekunden und verliefen, wie zynisch in den Protokollen festgehalten wurde, „ohne Besonderheiten“. Gefängnispfarrer Rieger sagte später von diesen letzten Minuten: „Von hinten legte sich eine Hand über die Augen des Opfers, links und rechts packten kräftige Hände zu, im Laufschritt ging es nach schneller Beiseiteschiebung eines Vorhangs durch eine offene Tür in einen wasch-küchenähnlichen Raum, und schon hallte durch das Gerichtszimmer und weithin durch den Korridor des Armesündertraktes der dumpfe Aufschlag des niedersausenden Fallbeils.“
***
Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend nur mehr einen Gedanken äußern. Wir können uns als heutige Gesellschaft unsere Geschichte nicht aussuchen. Aber wir haben die Wahl, woran wir uns erinnern wollen. Ob wir an die Widerständigen erinnern, wie heute, oder an ihre Mörder. Denn nichts anderes tun manche in unserem Land, wenn sie wie der aktuelle FPÖ-Nationalratspräsident Rosenkranz Menschen wie den Generalstaatsanwalt Johann Karl Stich, der an zentraler Stelle für diese Justizmorde verantwortlich war, als „Leistungsträger in Österreich zwischen 1918 und 1938“ bezeichnen.
Wir haben die Wahl – erinnern wir an die Opfer des Nationalsozialismus oder an ihre Täter? Lange wäre diese Frage rhetorisch gewesen, leider scheint sich die Welt derzeit in die andere Richtung zu drehen. Wenn „die Antifa“ verboten werden soll, soll in Wahrheit der Antifaschismus kriminalisiert werden – keine Organisation, sondern eine Haltung, die das Fundament unserer Demokratie im Jahr 1945 war und mit der wir uns heute an Leopold Hadáček, Johann Kníže, Josef Kníže, Felix Kolář und Albert Seifert erinnern.
Umso wichtiger ist es, mit Gedenkveranstaltungen wie der heutigen einen klaren Gegenpunkt zu setzen.




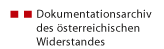


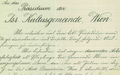








 English
English Termine
Termine Neues
Neues