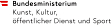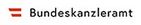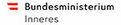Rede zum Gedenken an die während des Nationalsozialismus ermordeten Rom*nja und Sinti*zze
Am 1. August hielten das Bundesministerium für Inneres, das Land Burgenland und der Friedhof der Roma und Romnja und Sinti und Sintizze in Lackenbach eine Gedenkfeier anlässlich des nationalen Gedenktags zum Gedenken an die während des Nationalsozialismus ermordeten Rom*nja und Sinti*zze ab. DÖW-Leiter Andreas Kranebitter sollte eine Gedenkrede halten, musste seinen Besuch aber kurzfristig absagen, sein Redebeitrag wurde verlesen. Anbei findet sich die Rede in voller Länge.
Wenn man einen Ort sucht, der Österreich als Ganzes repräsentiert, der stellvertretend für Österreich steht, ist das eine schwierige, eigentlich unlösbare Aufgabe. Was die NS-Zeit anlangt, könnte Lackenbach allerdings in vielem ein solcher Ort sein. Die Geschichte Lackenbachs steht stellvertretend für die nationalsozialistische Geschichte und Nachgeschichte unseres Landes. Lackenbach erzählt viel über Österreich, über so manche österreichische Eigenheit, auch nach dem Ende des Nationalsozialismus.
Die jüdische Gemeinde in Lackenbach war groß und stellte einen großen Teil der Bevölkerung, bis sie nach dem „Anschluss“ nach Wien zwangsumgesiedelt wurde. Die Synagoge wurde gesprengt, zahlreiche Menschen wurden vertrieben, etwa 200 Jüdinnen und Juden im Holocaust ermordet. Es gab individuellen politischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Lackenbach. Das „Anhaltelager“ Lackenbach wurde zum Gefängnis, Durchgangslager und Sterbeort für tausende österreichische Rom*nja und Sinti*zze, betrieben von der Kriminalpolizei, nicht der Gestapo oder der SS. Und leider ist auch das eine österreichische Geschichte: Von all diesen Fakten wollte nach 1945 niemand reden, in Bezug auf Lackenbach hat das besonders lange gedauert. Niemand wollte von der jüdischen Gemeinde sprechen, niemand von der „Zigeunerverfolgung“, niemand von der verbrecherischen Kriminalpolizei, und auch niemand von den Überlebenden und ihrer Behandlung durch die österreichischen Behörden.
Reden wir zuerst von denen, über die vielleicht am längsten geschwiegen wurde – den Tätern: Von 1941 bis 1944 war der Leiter der Kriminalpolizeileitstelle Wien für die Verbrechen hier hauptverantwortlich, SS-Standartenführer Hans Karl Kaphengst. Der erste Kommandant von Lackenbach war SS-Obersturmführer Johann Kohlroß, sein Stellvertreter der berüchtigte Polizeibeamte und später zur Waffen-SS einberufene Franz Langmüller, der 1948 von einem Wiener Volksgericht der „Verbrechen der Quälerei und Mißhandlungen an den Lagerinsassen“ für schuldig befunden, aber nur zu einem Jahr Haft verurteilt wurde. Das waren im Großen und Ganzen die Folgen für die Täter. Zu lange gelang es der Kriminalpolizei in Österreich, sich als vermeintlich „saubere“ Einheit von Spezialisten der Verbrechensbekämpfung darzustellen – ein Bild, das erst in den letzten Jahren, u.a. in einem vom BMI beauftragten Projekt zur Aufarbeitung der Polizeigeschichte im Nationalsozialismus, zum Bröckeln gebracht werden konnte.
Gedenken wollen wir aber nicht der Täter, sondern der Opfer dieses Lagers. Am 5. Juni 1939 wurde in Berlin verfügt, dass zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ alle als „in besonderem Maße asozial“ diffamierten Rom*nja und Sinti*zze in „polizeiliche Vorbeugungshaft“ zu nehmen seien. Und noch einmal: Als Akteur war damals nicht die Gestapo oder die SS gemeint, das war ein Instrument der Kriminalpolizei. Sie konnte Menschen ohne Weiteres, völlig willkürlich für unbestimmte Zeit in Konzentrationslagern internieren. Es war der Startschuss zum Porajmos, der Ermordung hunderttausender Rom*nja und Sinti*zze, denn sie waren nun rechtlos und „vogelfrei“, wie das die Auschwitz-Überlebende und große Künstlerin Ceija Stojka ausdrückte. Es folgte ein „Festsetzungserlass“ im Oktober 1939, der es Romn*ja und Sinti*zze verbot, ihren Aufenthaltsort zu verlassen, und schließlich die Errichtung des Lagers Lackenbach im November 1940. Bis zu 2.335 Menschen waren gleichzeitig hier eingepfercht, auf viel zu engem Raum mit viel zu schlechter Versorgung. 237 Menschen starben an Flecktyphus, Unterernährung, Zwangsarbeit und den Misshandlungen. Von hier aus wurden Tausende nach Litzmannstadt deportiert – auf sie wartete der Tod dort oder in Auschwitz-Birkenau.
Ich möchte nun auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die trotz ihrer starken Worte viel zu wenig gehört wurden: die Verfolgten. Die folgenden Worte kommen von Lorenz und Theresia Hodosch, die 1954 in einem Brief schrieben, der sich im DÖW findet: „Zu schwersten Arbeiten wurden wir verwendet. […] Die Verpflegung bestand aus einer Wassersuppe und faule[n] Kartoffel. […] Frauen und Männern wurden die Haare kurz geschoren, täglich wurden wir von der SS-Wache geprügelt und auf jede Art und Weise geschunden und dressiert, man ließ uns in Schmutz und Läusen verkommen, mehr Schläge als zu Essen […]. Man hörte […] bis weit über den Lagerbereich hinaus das Schreien der Mißhandelten […]. Einmal war es so arg, daß die Bewohner vom Ort Lackenbach uns zu Hilfe kommen wollten, aber leider war so etwas nicht möglich. Dort in dieser Hölle habe wir fünf Jahre verbracht, dort wurde uns unser junges Leben geraubt und unsere Gesundheit vernichtet und heute verweigert man uns Lackenbacher[n] die Anerkennung, wir haben keinen Anspruch auf Amtsbescheinigung, wir bekommen keine Haftentschädigung und Wiedergutmachung, obwohl unser ganzer Hausrat und Möbel von der SS Lagerleitung verkauft wurde[n] und wir daher nach der Befreiung vor dem Nichts standen. Diese Erinnerung werden wir unser ganzes Leben nicht vergessen, auch unsere Kindeskinder werden noch davon erzählen. Wann endlich wird dieses himmelschreiende Unrecht an uns gut gemacht werden.“
Als Gefangene eines „Familienlagers“, das nicht der SS unterstand, wurden Opfer wie sie nicht in die sogenannte Opferfürsorge einbezogen. Das Anhaltelager galt den Behörden nicht als Zwangslager, das Leid von Theresia und Lorenz Hodosch galt ihnen nicht als Leid, wenn sie schrieben, dass „die im Lager Lackenbach untergebrachten Personen keineswegs wie Häftlinge gehalten wurden“. Damit hat die österreichische Verwaltung die Opfer ein zweites Mal gedemütigt, ein zweites Mal stigmatisiert. Erst im Jahre 1961, 16 Jahre nach Kriegsende, erhielten die „Lackenbacher“ nach der zwölften Novelle zum Opferfürsorgegesetz Entschädigungen für ihre „Freiheitsbeschränkung“, allerdings nur in der Höhe von 350 Schillingen im Monat und damit kaum der Hälfte des Betrages, der den Überlebenden anderer Konzentrationslager zugesprochen wurde. Es dauert bis 1988 – 43 Jahre nach Kriegsende –, bis Lackenbach anderen Zwangslagern behördlich gleichgestellt wurde. Und es dauerte bis zum Vorjahr, bis zur beinahe 70. Novelle des Gesetzes, als weitere Diskriminierungen beseitigt wurden.
Wir sind verleitet, die Geschichte als Fortschrittsgeschichte zu erzählen – so und so lange hat etwas gedauert, bis es heute endlich so weit ist, dass wir hier stehen und würdig gedenken. An Orten wie diesen stimmt das ja auch. Gedenkfeiern wie die heutige waren vor Jahrzehnten undenkbar, und ich danke allen Beteiligten an der Organisation der heutigen Gedenkfeier. Es darf aber nicht vergessen oder missachtet werden, dass Ressentiments gegen Minderheiten, dass ausgrenzender Rassismus, Roma- und Romnjafeindlichkeit und Antisemitismus, heute wieder im Steigen sind. Das zeigt nicht nur eine oft aufgeheizte öffentliche und mediale Debatte, das zeigen auch ganz nüchterne Zahlen. Wenn in Umfragen über ein Drittel der österreichischen Bevölkerung angibt, nicht neben Rom*nja und Sinti*zze leben zu wollen. Romafeindlichkeit steigt, still und heimlich, wenn antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus steigen. Es sind unterschiedliche, unterschiedlich strukturierte Vorurteile – aber sie steigen Hand in Hand. Mehr denn je gilt also, dass wir auf solchen Gedenkfeiern wie heute nicht nur vergangenen Verbrechen und die Erinnerung an ihre Opfer ansprechen müssen, sondern auch die Warnung vor der gegenwärtigen und zukünftigen Abwertung und Ausgrenzung verschiedener Gruppen oder als Gruppen wahrgenommener Menschen. Das geht uns alle an, das müssen wir alle adressieren.
Bevor ich schließe, möchte ich noch eine andere Angelegenheit erwähnen, die uns alle angeht, uns alle angehen sollte, wenn wir von einer würdigen Gedenkpolitik reden. Vor wenigen Tagen, am Sonntag, den 27. Juli, haben dutzende Polizeibeamt*innen ein Camp an der Gedenkstätte am Peršmanhof in Kärnten durchsucht, an dem in den letzten Tagen NS-Kriegsverbrechen an einer ganzen Kärntner slowenischen Familie verübt wurden. Die fadenscheinigen Begründungen für den Polizeieinsatz am Sonntag lauteten auf Verstöße gegen das Camping- und Naturschutzgesetz wie auch auf einen „sittenwidrigen Umgang“ mit der Gedenkstätte. Ich weiß nicht viel über die näheren Umstände, wir wissen immer noch nicht viel über die näheren Umstände – das ist genau der Punkt, den wir einfordern, das Auf-den-Tisch-Legen aller Fakten. Denn nichts, ich betone, nichts rechtfertigt einen Polizeieinsatz ohne Kontaktaufnahme mit den Organisatoren, mit der Gedenkstätte, mit dem Museum. Gedenkstätten und Gedenkfeiern sind hochsensible und würdige Angelegenheiten, die nicht zu stören sind – stellen Sie sich auch nur eine Sekunde einen Polizeieinsatz an der Shoah-Namensmauer in Wien, an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, hier und jetzt und heute in Lackenbach vor.
Es ist undenkbar, weil es undenkbar sein müsste. Das scheinen mir manche immer noch nicht verstanden zu haben. Ich bitte und ersuche das BMI hier also, ich verlange und fordere stellvertretend für viele, dass es die angekündigte lückenlose und offene Aufklärung dieser Vorkommnisse wahrmacht.
Ich habe am Beginn von unrühmlichen österreichischen Eigenheiten gesprochen. Das polizeiliche Stören von Gedenkfeiern darf keine solche werden.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
<< Weitere Beiträge aus der Rubrik „Neues“




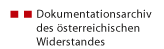


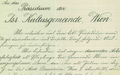


 English
English Termine
Termine Neues
Neues