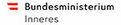Rudolf Gelbard, geboren 1930 in Wien, nach dem "Anschluss" 1938 Abbruch des Schulbesuchs aufgrund seiner jüdischen Herkunft, im Oktober 1942 mit seinen Eltern von Wien in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Nach der Befreiung 1945 Rückkehr nach Wien.
1975–1990 als Dokumentarist für Zeitgeschichte und Mitglied der Ombudsmann-Redaktion beim "Kurier" tätig. Als Zeitzeuge in Schulen, in der Erwachsenenbildung und im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen aktiv; Mitglied des Vorstands des DÖW.
Verstorben 2018
Ich kann mich genau erinnern, ich stand am Fenster, und plötzlich hat sich der Himmel sehr verfinstert. Das war während der "Kristallnacht", wie die Nazis die Tempel gesprengt haben. Die Umgebung der Tempelgasse – dort war der größte Tempel von Wien – war mit Staub bedeckt. Dann hat man schon die Lastautos gesehen, wie sie mit den verhafteten Juden auf der Franzensbrückenstraße gefahren sind. Da hab' ich schon gespürt, dass da Schreckliches passiert, denn die Leute auf den Lastautos haben so verschreckt gewirkt. Ich war doch schon fast acht Jahre alt, und das Geschehen damals war schon beängstigend. [...]
Es hat sich eigentlich sehr rasch das Gefühl eingestellt, dass für uns alles schlimmer wird. Ich kam in verschiedene Schulen und hatte dann ein sehr, sehr arges Erlebnis. Ich ging in die Schule in der Pazmanitengasse, und eines Tages, nachdem die Schule aus war, sind wir, die jüdischen Schüler, raus, und da hat ein HJ-Bann, also das müssen Hunderte Jungen gewesen sein, die Schule umstellt, und wir sind damals durch einen fürchterlichen Steinhagel durchgelaufen. Ich habe mir, kann ich mich erinnern, die Schultasche über den Kopf gehalten. Das war schon sehr arg. Das muss 1939 gewesen sein.
Ich erinnere mich auch an den Fall von Paris. Meine Mutter und ich waren damals in der Innenstadt, wir waren in einem Restaurant bei der Freyung. Alle standen auf und hoben die Hand zum Hitlergruß, als der Einmarsch der Deutschen in Paris im Radio bekanntgegeben wurde. Wir hätten ja in diesem Lokal gar nicht sein dürfen, wir waren aber drinnen. Ich kann mich gut erinnern, wie meine Mutter an der Wand lehnte, voll Schrecken, und die Hand so erhebt. Ich hab' ganz leger die Hand gehoben und hab' das Horst-Wessel-Lied, das konnte ich ja, so wie die Nazi-Chargen mit voller Inbrunst gesungen, weil ich gewusst hab': "Wenn die das singen, dann muss man das halt singen." Das wurde von der Umgebung sehr beifällig aufgenommen, dass da ein neunjähriger Junge so fehlerfrei singen konnte.
Dann flogen wir aus verschiedenen Wohnungen raus. [...]
Es gab auch sehr bald die Parkbänke mit der Aufschrift "Nur für Arier". Da war es schon ziemlich klar, auch für einen Zehnjährigen, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die sich sehr vorsichtig bewegen muss. Besonders, als es dann den "Stern" gab, bekam ich sehr oft meine "Flaschen", also Ohrfeigen, von HJ-Buben, bin angestänkert worden. Ich kann mich an ein sehr unangenehmes Erlebnis in der Böcklinstraße erinnern: Ich bin gegangen, und plötzlich ist eine Gruppe von vier Burschen gekommen. Ich war damals zehneinhalb Jahre. Der Anführer war siebzehn, die anderen waren vierzehn, fünfzehn Jahre. Sie haben mich in ein Haus gedrängt und wollten mich schlagen, und plötzlich sag' ich: "Was wollt's ihr von mir? Was hab' ich eigentlich gemacht?", so wienerisch habe ich gesprochen. Der Älteste, der Siebzehnjährige, hat mir einen "Spitz", einen Fußtritt, gegeben und hat gesagt: "Na ja, also gut, schleich dich, klaner Judenbua!" Das war noch das Wohlwollendste, was mir passieren konnte.
Eines war damals spürbar, nämlich dass sich unser Lebensraum immer mehr einengte. Das war beispielsweise auch spürbar bei den Lebensmittelkarten, man hat immer weniger zum Essen gehabt. Mit der "Salamitaktik" wurden die Juden immer mehr zurückgedrängt, zusammengedrängt, eingeschüchtert, bedroht und entmenschlicht. Das war auch für mich schon sehr deutlich spürbar. Ab dem zehnten Lebensjahr wusste ich: Das sind die Feinde. Das war mir schon klar. [...]
Mein Vater hatte die Möglichkeit, nach Shanghai zu fahren, aber nur alleine. Mein Vater wollte die Familie nicht alleine lassen, was unsere Rettung war, wie sich später herausgestellt hat, denn ohne meinen Vater hätten wir ja nie überlebt. Na, und dann war Schluss, wir konnten nicht mehr auswandern. Ich kann mich im Zusammenhang mit der Auswanderung noch erinnern, dass es eine Art Familienrat gab, bei einem Bruder meiner Mutter. Da waren dreißig Leute versammelt, von meinem Vater und meiner Mutter die Verwandten, und da ist so diskutiert worden: "Was meinst du? Uruguay? Kuba?" Da hab' ich Ländernamen gehört, die mir vollkommen unbekannt waren. [...]
Von meiner Mutter ist ein Bruder umgekommen, das war ein schwerer Kriegsinvalide des Ersten Weltkrieges, der verschiedene österreichische Tapferkeitsmedaillen gehabt hat. Sein Sohn und seine Frau sind wahrscheinlich in Litzmannstadt umgekommen. Von meinem zweiten Onkel sind seine Frau und die drei Kinder umgekommen. Der Onkel ging nach England, die Frau und die Kinder sind nach Ungarn geflüchtet. Die wurden 1944 dann in Auschwitz-Birkenau vergast. Das hat meinen Onkel unglaublich getroffen, er hat sich - er ist jetzt erst mit 86 Jahren gestorben -, vollkommen zurückgezogen ins Elternhaus und hat mit fast niemandem mehr verkehrt. Dann ist meine Großmutter umgekommen. Die ist vor uns noch nach Theresienstadt deportiert worden. Als wir nach Theresienstadt gekommen sind, haben wir erfahren, dass sie eine Woche vorher von Theresienstadt in ein Vernichtungslager gekommen ist, nach Maly Trostinec. [...] Das hat uns sehr, sehr getroffen, wie wir nach Theresienstadt gekommen sind, und die Großmutter ist eine Woche vorher in dieses Lager gebracht worden. [...]
Unsere ursprüngliche Wohnung ist 1939 "arisiert" worden, von jemandem aus unserem Haus. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, ich glaube, die haben Weigel geheißen. Die haben gesagt: "Wir haben jahrelang in einem nassen Kammerl gewohnt. Jetzt zieht ihr dort ein." Wir haben eine Zeitlang dort gewohnt, und dann ging's durch den 2. Bezirk. Wir haben ein paar Quartiere mit anderen jüdischen Familien zusammen gehabt, es haben ja immer mehrere Familien in einer Wohnung leben müssen, wir sind immer mehr zusammengedrängt worden. Unser vorletztes Quartier war ein Gassenlokal in der Rotenkreuzgasse, die ist da bei der Pfarrgasse im 2. Bezirk. Ich konnte nach 1945 viele Jahre nicht in den 2. Bezirk gehen, weil die Erinnerungen so stark waren. [...] Damals wussten wir schon: Wir sind Bürger fünfter Klasse.
Zum Schluss wohnten wir "Im Werd", in einem Zimmer, von dort sind wir nach Theresienstadt deportiert worden.




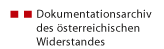







 English
English Termine
Termine Neues
Neues